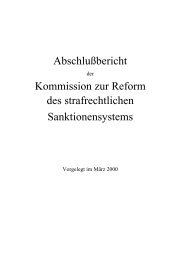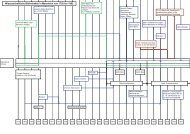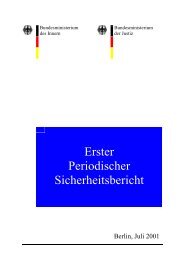Innere Sicherheit
Innere Sicherheit
Innere Sicherheit
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Seite 118<br />
PSB<br />
Bei der repräsentativen Bevölkerungsumfrage ALLBUS 1990 räumte jeder sechste Befragte ein, schon<br />
mal einen Ladendiebstahl begangen zu haben. Dabei wurden nur Erwachsene befragt; Jugendliche und<br />
Kinder, deren Anteil regelmäßig mehr als ein Drittel der Tatverdächtigen ausmacht, waren nicht einbezogen.<br />
Eine Ausweitung der Befragung auf die Altersgruppe Minderjähriger hätte zu einem höheren Prozentsatz<br />
geführt.<br />
Bei der Bestimmung des Schadens kann nicht der Wert der bei den gefassten Tätern gefundenen Waren in<br />
Ansatz gebracht werden, weil regelmäßig die von ihnen gestohlenen Gegenstände dem Geschäft zurückgegeben<br />
werden. Es muss vielmehr um die Schätzung des durch nicht entdeckten Ladendiebstahl verursachten<br />
Schadens gehen. Dafür werden zwei Ansätze benutzt. Entweder wird der Gesamtwert der von<br />
gefassten Ladendieben an sich genommenen Waren (1999: 73.350.311 DM) als Basis herangezogen.<br />
Durch Multiplikation mit einer geschätzten Dunkelfeld-Relation kann der Gesamtschaden kalkuliert werden.<br />
Oder die Inventurdifferenz des Handels (etwa 1,2% des Bruttoumsatzes) wird als Ausgangspunkt<br />
genommen, und der Anteil verschiedener Verlustquellen daran geschätzt. Neben Diebstahl durch Kunden<br />
und Personal gehören dazu Bruch, Verderb der Waren, Fehler bei Wareneingang, falsche Preisauszeichnung<br />
und Irrtümer beim Verkauf sowie logistische Mängel. Über den Anteil, den Personaldelikte ausmachen,<br />
variieren Schätzungen zwischen 20 und 40 Prozent. 356 Entsprechend bewegen sich die Schätzungen<br />
des Anteils von Kundendiebstahl zwischen 40 und 55%. 357 Diese zweite Schätzmethode ergibt ein Vielfaches<br />
der ersten und ist deshalb umstritten. Wie der Handel diese regelmäßig auftretende und daher seit<br />
längerem bekannte Inventurdifferenz von etwa 1,2% durch Gegenmaßnahmen zu senken versucht, ist<br />
eine Frage der Investitionen in <strong>Sicherheit</strong>stechnik. Mit Hilfe von elektronischen <strong>Sicherheit</strong>stechnologien<br />
wird eine Halbierung der Inventurdifferenzen für möglich gehalten.<br />
2.3.4.1.2 Problemanalyse<br />
Da Ladendiebstahl jährlich etwa 10% der Gesamtkriminalität und fast 20% aller Diebstähle überhaupt<br />
ausmacht, und somit durch bessere Prävention die Kriminalitätsrate erheblich gesenkt werden könnte,<br />
lohnt ein näheres Eingehen auf die Rahmenbedingungen dieser Straftat.<br />
(1) Ladendiebstahl ist ein Kontrolldelikt. Er wird nur entdeckt, wenn der Spürsinn von Personal und Detektiven<br />
erfolgreich eingesetzt wurde. Dies hat zweierlei Konsequenzen. Erstens hängt die Zahl registrierter<br />
Delikte weitgehend von den Überwachungsstrategien der Mitarbeiter und Detektive ab sowie von<br />
dem Aufwand, der technischen <strong>Sicherheit</strong>svorkehrungen eingeräumt wird. Je besser die relative Kontrolldichte,<br />
desto höher ist die Zahl entdeckter Täter. 358<br />
Zweitens hängt bei Kontrolldelikten die soziale Zusammensetzung der Tatverdächtigen von Verdachtsstrategien<br />
der Detektive ab. Deren Selektionskriterien leiten die gezielte Überwachung von Kunden an.<br />
Gesteigerte Aufmerksamkeit für bestimmte Personenkreise (z. B. mutmaßliche Asylbewerber) erhöht<br />
deren Anteil unter den gefassten Dieben. Es ist nicht auszuschließen, dass deshalb in den letzten Jahren<br />
(nach Rückgang der Asylbewerberzahlen) in wachsendem Maße Kinder als Tatverdächtige identifiziert<br />
wurden. Mittlerweile werden mehr als die Hälfte der insgesamt einer Tat verdächtigten Kinder wegen<br />
Ladendiebstahls der Polizei gemeldet. Es bedarf weiterer Recherche, ob sich darin eine Tendenz niederschlägt,<br />
die als "Lüchow-Dannenberg-Syndrom" bekannt ist: Je günstiger die Relation „Taten je Polizist“<br />
ausfällt, desto mehr Bagatellen und Taten von Kindern werden verfolgt 359 . Auch eine gesunkene Toleranz<br />
gegenüber Normbrüchen der Kinder kann eine Rolle spielen.<br />
356 Vgl. VON POGRELL, H., 1999, S. 45; SCHMECHTIG, B., 1982, S. 4.<br />
357 Vgl. PETERSEN, O., 1997, S. 16.<br />
358 Vgl. MICHAELIS, J., 1991, S. 35.<br />
359 Vgl. PFEIFFER, C., 1987, S. 34.