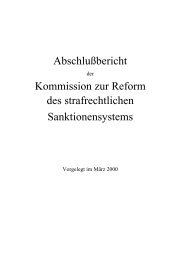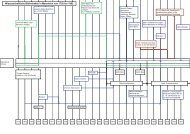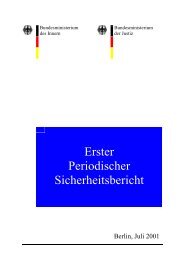Innere Sicherheit
Innere Sicherheit
Innere Sicherheit
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Seite 46<br />
mit 100.000 bis 500.000 Menschen lebt als im Norden. Der größte Unterschied der Häufigkeitszahl der<br />
Gewalt ergibt sich hier im Vergleich der Dörfer und Kleinstädte. Sie sind in der Region Nord-Osten um<br />
fast drei Fünftel höher belastet als im Süd-Osten.<br />
Im Ost-West-Vergleich wird erst durch die Differenzierung nach Ortsgrößen erkennbar, dass die ausgeprägtesten<br />
regionalen Unterschiede der Gewaltbelastung im Verhältnis des Nord-Ostens zum Süd-Westen<br />
bestehen. Die Häufigkeitszahlen der drei Siedlungstypen übersteigen hier die des Süd-Westens um etwa<br />
das 1,8fache. Aber auch im Vergleich der beiden Nordgebiete zeigt sich bei der Gegenüberstellung der<br />
Zahlen zu den Ortsgrößen für den Osten eine deutlich höhere Gewaltbelastung. Am stärksten divergieren<br />
hier die Häufigkeitszahlen der Dörfer und Kleinstädte bis 20.000 Einwohner. Die Tatsache, dass sich<br />
insgesamt für den Nord-Westen eine höhere Belastung ergibt als für den Nord-Osten, ist ausschließlich<br />
die Folge der unterschiedlichen Siedlungsstrukturen sowie davon, dass Berlin trotz seiner geographischen<br />
Lage nicht dem Nord-Osten zugerechnet wurde. Berlin selber weist im Vergleich der Großstädte mit<br />
613,7 Gewalttaten pro 100.000 Einwohner die höchste Belastung auf.<br />
Die Frage, wie diese regionalen Unterschiede der polizeilich registrierten Gewaltbelastung zu erklären<br />
sind, ist bisher nicht systematisch untersucht worden. Dies gilt sowohl im Hinblick auf das starke Stadt-<br />
Land-Gefälle wie auch in Bezug auf die großen Unterschiede, die sich insbesondere im Vergleich der<br />
Häufigkeitszahlen von Städten und Gemeinden im Nord-Osten der Republik mit denen derselben<br />
Ortsgrößenklasse im Süd-Westen gezeigt haben. Es gibt allerdings Einzeluntersuchungen, die verschiedene<br />
Erklärungsangebote nahe legen. Mehrere Studien bieten empirische Anhaltspunkte dafür, dass die<br />
festgestellten Divergenzen zumindest teilweise auf regionalen Unterschieden der ökonomischen Strukturen<br />
sowie der Stärke und Bindungskraft sozialer Netzwerke beruhen. 163 So fand OHLEMACHER bei einer<br />
Analyse von Landkreisen, Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen neben<br />
einem Effekt von Armut auf die Rate registrierter Raubdelikte auch einen deutlichen Zusammenhang<br />
zwischen Urbanisierung sowie sozialer Desorganisation (Scheidung und Mobilität) einerseits und Raub<br />
sowie personalen Gewaltdelikten andererseits, womit multivariat ein erheblicher Anteil der Varianz der<br />
registrierten Delikte zwischen den untersuchten Regionen aufgeklärt werden konnte.<br />
Ursache-Wirkungs-Beziehungen sind damit freilich nicht nachgewiesen. Da den Berechnungen nicht<br />
Individual-, sondern Aggregatdaten von Regionen zugrunde liegen, ist eine Schluss auf die Ebene von<br />
Personen nicht zulässig; dies wäre ein so genannter ökologischer Fehlschluss. Es liegen jedoch weitere<br />
empirische Befunde vor, die im Zusammenhang mit theoretischen Überlegungen die These stützen, dass<br />
soziale Belastungen mit einer Erhöhung des Risikos von Gewaltdelikten einhergehen. So zeigt sich, dass<br />
eingeschränkte ökonomische Ressourcen bei den betroffenen Familien das Ausmaß gemeinsamer familiärer<br />
Tätigkeiten reduzieren und gleichzeitig das innerfamiliäre Klima erheblich belasten. 164 Armut ist ein<br />
Stressfaktor, der Konflikte schafft und deren Bewältigung erschwert. Die vor diesem Hintergrund entstehenden<br />
emotionalen Belastungen, aggressive wie auch depressive Tendenzen, erschweren es Jugendlichen<br />
aus solchen Familien, den schulischen und betrieblichen Anforderungen gerecht zu werden. Mit<br />
schulischem Scheitern wird auch Arbeitslosigkeit wahrscheinlicher. Der Anschluss an deviante Cliquen,<br />
in dem Bestreben, fehlende Anerkennung und Gefühle der Benachteiligung zu kompensieren, wird subjektiv<br />
sinnvoll. Die aggregierten Daten der unterschiedlichen Regionen lassen vermuten, dass sich dieser<br />
Zusammenhang von ökonomischen Problemen, familiären Konflikte und Jugenddelinquenz, insbesondere<br />
auch Gewaltdelinquenz, nicht nur in speziellen Wohngebieten, sondern in ganzen Regionen etabliert hat.<br />
In diesem Zusammenhang ist ergänzend auf einen Problembereich hinzuweisen, der vor allem in den<br />
Wirtschaftswissenschaften diskutiert wird: Kriminalität als Standortfaktor bei ökonomisch relevanten<br />
163<br />
Vgl. PFEIFFER, C. und T. OHLEMACHER, 1995, sowie OHLEMACHER, T., 1995, der zugleich einen Überblick über die internationale<br />
Literatur bietet.<br />
164<br />
BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND (Hg.), Zehnter Kinder- und Jugendbericht, S. 92 f., 113.<br />
PSB