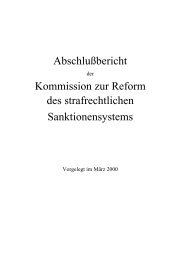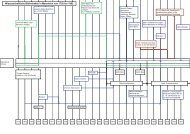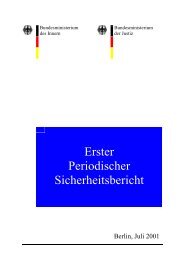Innere Sicherheit
Innere Sicherheit
Innere Sicherheit
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
PSB Seite 293<br />
pointierten Variante wird der neue Rechtsextremismus als Konsequenz der neoliberalen Marktradikalität<br />
angesetzt: "Der aktuelle Rechtsextremismus und Rechtspopulismus beruht auf einer Brutalisierung, Ethnisierung<br />
und Ästhetisierung alltäglicher Konkurrenzprinzipien." 926 Offen bleibt freilich, warum sich die<br />
fremdenfeindliche Gewalt schubartig in den neunziger Jahren ausgebreitet hat.<br />
Auf diese Fragen antwortet - drittens - die These des „Konflikts um die Einwanderung“, die die Eskalation<br />
von Einwanderungskonflikten und die politische Brisanz von Fremdheitserfahrungen in den Vordergrund<br />
rückt. Die massive Zuwanderung von über vier Millionen Aussiedlern und Asylbewerbern zwischen<br />
1988 und 1992 hat zu zunehmendem Stress und Konflikten in den Aufnahmeorten geführt. Dem<br />
folgte eine intensive Einwanderungs- und Asylrechtsdebatte, während der sich die in Bund und Ländern<br />
regierenden Parteien bis zum Asylrechtskompromiss von 1993 nicht auf einen Weg der Problembewältigung<br />
einigen konnten. Dies wiederum hat Chancen für rechte Parteien und jugendliche Schläger eröffnet.<br />
In Teilen der Bevölkerung entwickeln sich Vorstellungen von Konkurrenz um Arbeitsplätze und Wohnraum<br />
und einer "ungerechten" Bevorzugung von Einwanderern durch den Staat. In diesem Zusammenhang<br />
wird die Zugehörigkeit zum deutschen Volk als Ausschließungsgrund gegen Einwanderer für viele<br />
attraktiv. 927 Über den Volksgedanken findet dann auch der Antisemitismus und der Kampf gegen<br />
"Schädlinge des Volkes" eine neue Renaissance. In diesem Zusammenhang konnten sich gewaltbereite<br />
fremdenfeindliche jugendliche Subkulturen eine politische Bedeutung zuschreiben. Erklärt wird freilich<br />
durch diese Entstehungsbedingungen nicht, warum Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus sich in<br />
den neuen Ländern verstärkt festgesetzt haben, in denen vergleichsweise wenige Zuwanderer leben.<br />
Hierfür wird - viertens - neben dem Hinweis darauf, dass die Bürger der DDR kaum Gelegenheit hatten,<br />
den Umgang mit Einwanderern zu lernen, vor allem die These der autoritären Reaktion auf Anomie ins<br />
Feld geführt. Die Verunsicherung durch den Zusammenbruch des sozialistischen Systems, verstärkt durch<br />
die ganz neue Angst vor Arbeitslosigkeit, führt zu dem Versuch, sich durch die Zugehörigkeit zu dem<br />
"einen Volk" zu stabilisieren 928 , das dann gegen „Eindringlinge“ verteidigt werden muss.<br />
Die vier Erklärungsmuster sind teilweise durchaus kompatibel. Probleme familialer Sozialisation können<br />
zu verstärkter Vorurteilsneigung und Gewaltbereitschaft führen. Unter den Bedingungen einer verstärkt<br />
wahrgenommenen ökonomisch-beruflichen Konkurrenzsituation sowie angesichts der Vorstellungen von<br />
einer Gemeinschaft, die gegen einen weiteren Zustrom zu verteidigen sei, können Vorurteile und Gewaltbereitschaften<br />
dann durchaus handlungswirksam werden.<br />
Über diese Erklärungen von Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus in den neunziger Jahren hinaus<br />
ist zu bedenken, dass alle Ideen attraktiv sind, die das Individuum als Teil eines größeren Ganzen<br />
begreifen und dem einzelnen Lebenslauf einen Sinn zuweisen, der aus der Mitwirkung an dem vorgestellten<br />
Schicksal der imaginierten Gemeinschaft erwächst. Gerade für junge Leute, deren Leben noch<br />
nicht in den Routinen des Alltags seine Aufgaben und Erfüllungen findet, sind solche Konzeptionen<br />
faszinierend. Eben darum dürfte die Erkenntnis, dass die Menschheit gegenwärtig zu einer Weltgesellschaft<br />
zusammen findet und darum einer humanen und ökologischen Solidarität bedarf, und die Erfahrung,<br />
dass man an diesem Auftrag auch in Gemeinschaft mit Anderen mitwirken kann, geeignet sei, nationalistischen<br />
und rassistischen Ideologien entgegenzutreten. Der Mensch ist nicht nur homo oeconomicus,<br />
sondern auch homo politicus - im Schlechten wie im Guten.<br />
926 MENSCHIK-BENDELE, J. und K. OTTOMEYER, 2000, S. 303; ähnlich auch BUTTERWEGE, C., 2000, der freilich stärker die<br />
Konkurrenzideologie des Neoliberalismus in den Vordergrund rückt.<br />
927 Vgl. hierzu WILLEMS, H., 1993, 1997; BAURMANN, M., 1997; ECKERT, R. (Hg.), 1998, ECKERT, R., 1999.<br />
928 Vgl. ÖSTERREICH, D., 1998, AHLHEIM, K. und B. HEGER, 2000.