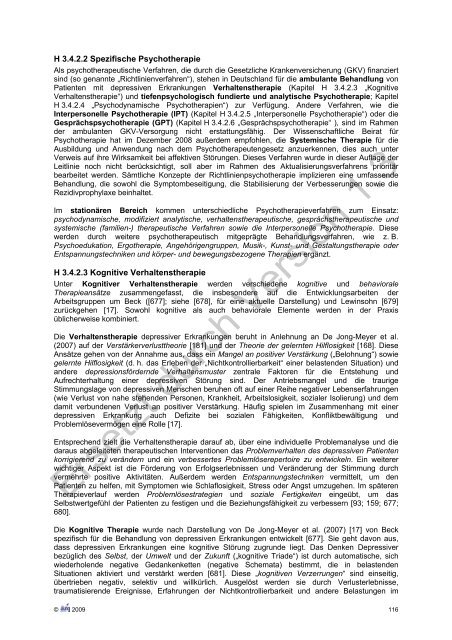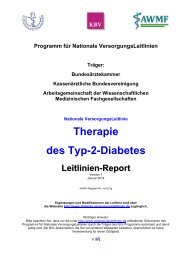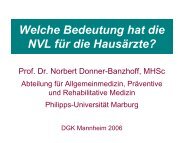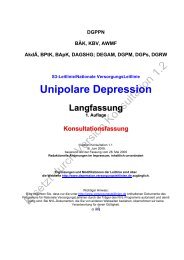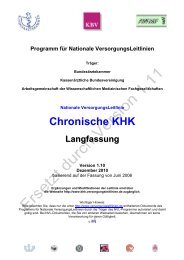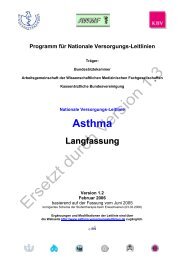Unipolare Depression Langfassung - Versorgungsleitlinien.de
Unipolare Depression Langfassung - Versorgungsleitlinien.de
Unipolare Depression Langfassung - Versorgungsleitlinien.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
H 3.4.2.2 Spezifische Psychotherapie<br />
Als psychotherapeutische Verfahren, die durch die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) finanziert<br />
sind (so genannte „Richtlinienverfahren“), stehen in Deutschland für die ambulante Behandlung von<br />
Patienten mit <strong>de</strong>pressiven Erkrankungen Verhaltenstherapie (Kapitel H 3.4.2.3 „Kognitive<br />
Verhaltenstherapie“) und tiefenpsychologisch fundierte und analytische Psychotherapie; Kapitel<br />
H 3.4.2.4 „Psychodynamische Psychotherapien“) zur Verfügung. An<strong>de</strong>re Verfahren, wie die<br />
Interpersonelle Psychotherapie (IPT) (Kapitel H 3.4.2.5 „Interpersonelle Psychotherapie“) o<strong>de</strong>r die<br />
Gesprächspsychotherapie (GPT) (Kapitel H 3.4.2.6 „Gesprächspsychotherapie“ ), sind im Rahmen<br />
<strong>de</strong>r ambulanten GKV-Versorgung nicht erstattungsfähig. Der Wissenschaftliche Beirat für<br />
Psychotherapie hat im Dezember 2008 außer<strong>de</strong>m empfohlen, die Systemische Therapie für die<br />
Ausbildung und Anwendung nach <strong>de</strong>m Psychotherapeutengesetz anzuerkennen, dies auch unter<br />
Verweis auf ihre Wirksamkeit bei affektiven Störungen. Dieses Verfahren wur<strong>de</strong> in dieser Auflage <strong>de</strong>r<br />
Leitlinie noch nicht berücksichtigt, soll aber im Rahmen <strong>de</strong>s Aktualisierungsverfahrens prioritär<br />
bearbeitet wer<strong>de</strong>n. Sämtliche Konzepte <strong>de</strong>r Richtlinienpsychotherapie implizieren eine umfassen<strong>de</strong><br />
Behandlung, die sowohl die Symptombeseitigung, die Stabilisierung <strong>de</strong>r Verbesserungen sowie die<br />
Rezidivprophylaxe beinhaltet.<br />
Im stationären Bereich kommen unterschiedliche Psychotherapieverfahren zum Einsatz:<br />
psychodynamische, modifiziert analytische, verhaltenstherapeutische, gesprächstherapeutische und<br />
systemische (familien-) therapeutische Verfahren sowie die Interpersonelle Psychotherapie. Diese<br />
wer<strong>de</strong>n durch weitere psychotherapeutisch mitgeprägte Behandlungsverfahren, wie z. B.<br />
Psychoedukation, Ergotherapie, Angehörigengruppen, Musik-, Kunst- und Gestaltungstherapie o<strong>de</strong>r<br />
Entspannungstechniken und körper- und bewegungsbezogene Therapien ergänzt.<br />
H 3.4.2.3 Kognitive Verhaltenstherapie<br />
Unter Kognitiver Verhaltenstherapie wer<strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>ne kognitive und behaviorale<br />
Therapieansätze zusammengefasst, die insbeson<strong>de</strong>re auf die Entwicklungsarbeiten <strong>de</strong>r<br />
Arbeitsgruppen um Beck ([677]; siehe [678], für eine aktuelle Darstellung) und Lewinsohn [679]<br />
zurückgehen [17]. Sowohl kognitive als auch behaviorale Elemente wer<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Praxis<br />
üblicherweise kombiniert.<br />
Die Verhaltenstherapie <strong>de</strong>pressiver Erkrankungen beruht in Anlehnung an De Jong-Meyer et al.<br />
(2007) auf <strong>de</strong>r Verstärkerverlusttheorie [181] und <strong>de</strong>r Theorie <strong>de</strong>r gelernten Hilflosigkeit [168]. Diese<br />
Ansätze gehen von <strong>de</strong>r Annahme aus, dass ein Mangel an positiver Verstärkung („Belohnung“) sowie<br />
gelernte Hilflosigkeit (d. h. das Erleben <strong>de</strong>r „Nichtkontrollierbarkeit“ einer belasten<strong>de</strong>n Situation) und<br />
an<strong>de</strong>re <strong>de</strong>pressionsför<strong>de</strong>rn<strong>de</strong> Verhaltensmuster zentrale Faktoren für die Entstehung und<br />
Aufrechterhaltung einer <strong>de</strong>pressiven Störung sind. Der Antriebsmangel und die traurige<br />
Stimmungslage von <strong>de</strong>pressiven Menschen beruhen oft auf einer Reihe negativer Lebenserfahrungen<br />
(wie Verlust von nahe stehen<strong>de</strong>n Personen, Krankheit, Arbeitslosigkeit, sozialer Isolierung) und <strong>de</strong>m<br />
damit verbun<strong>de</strong>nen Verlust an positiver Verstärkung. Häufig spielen im Zusammenhang mit einer<br />
<strong>de</strong>pressiven Erkrankung auch Defizite bei sozialen Fähigkeiten, Konfliktbewältigung und<br />
Problemlösevermögen eine Rolle [17].<br />
Entsprechend zielt die Verhaltenstherapie darauf ab, über eine individuelle Problemanalyse und die<br />
daraus abgeleiteten therapeutischen Interventionen das Problemverhalten <strong>de</strong>s <strong>de</strong>pressiven Patienten<br />
korrigierend zu verän<strong>de</strong>rn und ein verbessertes Problemlöserepertoire zu entwickeln. Ein weiterer<br />
wichtiger Aspekt ist die För<strong>de</strong>rung von Erfolgserlebnissen und Verän<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Stimmung durch<br />
vermehrte positive Aktivitäten. Außer<strong>de</strong>m wer<strong>de</strong>n Entspannungstechniken vermittelt, um <strong>de</strong>n<br />
Patienten zu helfen, mit Symptomen wie Schlaflosigkeit, Stress o<strong>de</strong>r Angst umzugehen. Im späteren<br />
Therapieverlauf wer<strong>de</strong>n Problemlösestrategien und soziale Fertigkeiten eingeübt, um das<br />
Selbstwertgefühl <strong>de</strong>r Patienten zu festigen und die Beziehungsfähigkeit zu verbessern [93; 159; 677;<br />
680].<br />
Die Kognitive Therapie wur<strong>de</strong> nach Darstellung von De Jong-Meyer et al. (2007) [17] von Beck<br />
spezifisch für die Behandlung von <strong>de</strong>pressiven Erkrankungen entwickelt [677]. Sie geht davon aus,<br />
dass <strong>de</strong>pressiven Erkrankungen eine kognitive Störung zugrun<strong>de</strong> liegt. Das Denken Depressiver<br />
bezüglich <strong>de</strong>s Selbst, <strong>de</strong>r Umwelt und <strong>de</strong>r Zukunft („kognitive Tria<strong>de</strong>“) ist durch automatische, sich<br />
wie<strong>de</strong>rholen<strong>de</strong> negative Gedankenketten (negative Schemata) bestimmt, die in belasten<strong>de</strong>n<br />
Situationen aktiviert und verstärkt wer<strong>de</strong>n [681]. Diese „kognitiven Verzerrungen“ sind einseitig,<br />
übertrieben negativ, selektiv und willkürlich. Ausgelöst wer<strong>de</strong>n sie durch Verlusterlebnisse,<br />
traumatisieren<strong>de</strong> Ereignisse, Erfahrungen <strong>de</strong>r Nichtkontrollierbarkeit und an<strong>de</strong>re Belastungen im<br />
© 2009 116