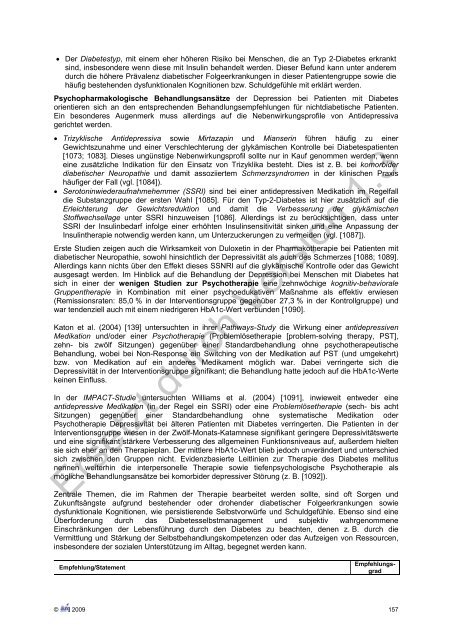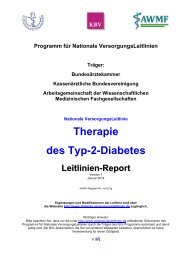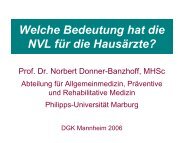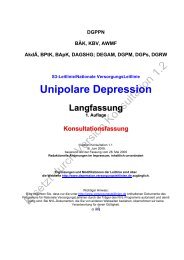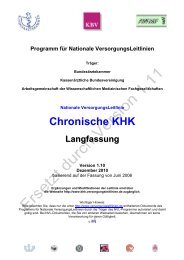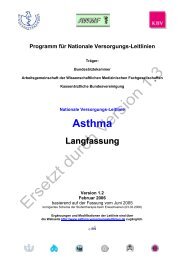Unipolare Depression Langfassung - Versorgungsleitlinien.de
Unipolare Depression Langfassung - Versorgungsleitlinien.de
Unipolare Depression Langfassung - Versorgungsleitlinien.de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
� Der Diabetestyp, mit einem eher höheren Risiko bei Menschen, die an Typ 2-Diabetes erkrankt<br />
sind, insbeson<strong>de</strong>re wenn diese mit Insulin behan<strong>de</strong>lt wer<strong>de</strong>n. Dieser Befund kann unter an<strong>de</strong>rem<br />
durch die höhere Prävalenz diabetischer Folgeerkrankungen in dieser Patientengruppe sowie die<br />
häufig bestehen<strong>de</strong>n dysfunktionalen Kognitionen bzw. Schuldgefühle mit erklärt wer<strong>de</strong>n.<br />
Psychopharmakologische Behandlungsansätze <strong>de</strong>r <strong>Depression</strong> bei Patienten mit Diabetes<br />
orientieren sich an <strong>de</strong>n entsprechen<strong>de</strong>n Behandlungsempfehlungen für nichtdiabetische Patienten.<br />
Ein beson<strong>de</strong>res Augenmerk muss allerdings auf die Nebenwirkungsprofile von Anti<strong>de</strong>pressiva<br />
gerichtet wer<strong>de</strong>n.<br />
� Trizyklische Anti<strong>de</strong>pressiva sowie Mirtazapin und Mianserin führen häufig zu einer<br />
Gewichtszunahme und einer Verschlechterung <strong>de</strong>r glykämischen Kontrolle bei Diabetespatienten<br />
[1073; 1083]. Dieses ungünstige Nebenwirkungsprofil sollte nur in Kauf genommen wer<strong>de</strong>n, wenn<br />
eine zusätzliche Indikation für <strong>de</strong>n Einsatz von Trizyklika besteht. Dies ist z. B. bei komorbi<strong>de</strong>r<br />
diabetischer Neuropathie und damit assoziiertem Schmerzsyndromen in <strong>de</strong>r klinischen Praxis<br />
häufiger <strong>de</strong>r Fall (vgl. [1084]).<br />
� Serotoninwie<strong>de</strong>raufnahmehemmer (SSRI) sind bei einer anti<strong>de</strong>pressiven Medikation im Regelfall<br />
die Substanzgruppe <strong>de</strong>r ersten Wahl [1085]. Für <strong>de</strong>n Typ-2-Diabetes ist hier zusätzlich auf die<br />
Erleichterung <strong>de</strong>r Gewichtsreduktion und damit die Verbesserung <strong>de</strong>r glykämischen<br />
Stoffwechsellage unter SSRI hinzuweisen [1086]. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass unter<br />
SSRI <strong>de</strong>r Insulinbedarf infolge einer erhöhten Insulinsensitivität sinken und eine Anpassung <strong>de</strong>r<br />
Insulintherapie notwendig wer<strong>de</strong>n kann, um Unterzuckerungen zu vermei<strong>de</strong>n (vgl. [1087]).<br />
Erste Studien zeigen auch die Wirksamkeit von Duloxetin in <strong>de</strong>r Pharmakotherapie bei Patienten mit<br />
diabetischer Neuropathie, sowohl hinsichtlich <strong>de</strong>r Depressivität als auch <strong>de</strong>s Schmerzes [1088; 1089].<br />
Allerdings kann nichts über <strong>de</strong>n Effekt dieses SSNRI auf die glykämische Kontrolle o<strong>de</strong>r das Gewicht<br />
ausgesagt wer<strong>de</strong>n. Im Hinblick auf die Behandlung <strong>de</strong>r <strong>Depression</strong> bei Menschen mit Diabetes hat<br />
sich in einer <strong>de</strong>r wenigen Studien zur Psychotherapie eine zehnwöchige kognitiv-behaviorale<br />
Gruppentherapie in Kombination mit einer psychoedukativen Maßnahme als effektiv erwiesen<br />
(Remissionsraten: 85,0 % in <strong>de</strong>r Interventionsgruppe gegenüber 27,3 % in <strong>de</strong>r Kontrollgruppe) und<br />
war ten<strong>de</strong>nziell auch mit einem niedrigeren HbA1c-Wert verbun<strong>de</strong>n [1090].<br />
Katon et al. (2004) [139] untersuchten in ihrer Pathways-Study die Wirkung einer anti<strong>de</strong>pressiven<br />
Medikation und/o<strong>de</strong>r einer Psychotherapie (Problemlösetherapie [problem-solving therapy, PST],<br />
zehn- bis zwölf Sitzungen) gegenüber einer Standardbehandlung ohne psychotherapeutische<br />
Behandlung, wobei bei Non-Response ein Switching von <strong>de</strong>r Medikation auf PST (und umgekehrt)<br />
bzw. von Medikation auf ein an<strong>de</strong>res Medikament möglich war. Dabei verringerte sich die<br />
Depressivität in <strong>de</strong>r Interventionsgruppe signifikant; die Behandlung hatte jedoch auf die HbA1c-Werte<br />
keinen Einfluss.<br />
In <strong>de</strong>r IMPACT-Studie untersuchten Williams et al. (2004) [1091], inwieweit entwe<strong>de</strong>r eine<br />
anti<strong>de</strong>pressive Medikation (in <strong>de</strong>r Regel ein SSRI) o<strong>de</strong>r eine Problemlösetherapie (sech- bis acht<br />
Sitzungen) gegenüber einer Standardbehandlung ohne systematische Medikation o<strong>de</strong>r<br />
Psychotherapie Depressivität bei älteren Patienten mit Diabetes verringerten. Die Patienten in <strong>de</strong>r<br />
Interventionsgruppe wiesen in <strong>de</strong>r Zwölf-Monats-Katamnese signifikant geringere Depressivitätswerte<br />
und eine signifikant stärkere Verbesserung <strong>de</strong>s allgemeinen Funktionsniveaus auf, außer<strong>de</strong>m hielten<br />
sie sich eher an <strong>de</strong>n Therapieplan. Der mittlere HbA1c-Wert blieb jedoch unverän<strong>de</strong>rt und unterschied<br />
sich zwischen <strong>de</strong>n Gruppen nicht. Evi<strong>de</strong>nzbasierte Leitlinien zur Therapie <strong>de</strong>s Diabetes mellitus<br />
nennen weiterhin die interpersonelle Therapie sowie tiefenpsychologische Psychotherapie als<br />
mögliche Behandlungsansätze bei komorbi<strong>de</strong>r <strong>de</strong>pressiver Störung (z. B. [1092]).<br />
Zentrale Themen, die im Rahmen <strong>de</strong>r Therapie bearbeitet wer<strong>de</strong>n sollte, sind oft Sorgen und<br />
Zukunftsängste aufgrund bestehen<strong>de</strong>r o<strong>de</strong>r drohen<strong>de</strong>r diabetischer Folgeerkrankungen sowie<br />
dysfunktionale Kognitionen, wie persistieren<strong>de</strong> Selbstvorwürfe und Schuldgefühle. Ebenso sind eine<br />
Überfor<strong>de</strong>rung durch das Diabetesselbstmanagement und subjektiv wahrgenommene<br />
Einschränkungen <strong>de</strong>r Lebensführung durch <strong>de</strong>n Diabetes zu beachten, <strong>de</strong>nen z. B. durch die<br />
Vermittlung und Stärkung <strong>de</strong>r Selbstbehandlungskompetenzen o<strong>de</strong>r das Aufzeigen von Ressourcen,<br />
insbeson<strong>de</strong>re <strong>de</strong>r sozialen Unterstützung im Alltag, begegnet wer<strong>de</strong>n kann.<br />
Empfehlung/Statement<br />
Empfehlungsgrad<br />
© 2009 157