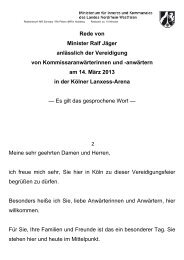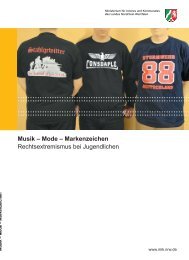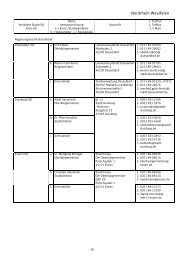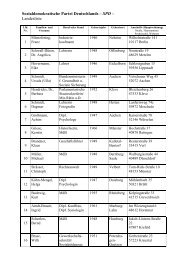Inhaltsverzeichnis - MIK NRW - Landesregierung Nordrhein-Westfalen
Inhaltsverzeichnis - MIK NRW - Landesregierung Nordrhein-Westfalen
Inhaltsverzeichnis - MIK NRW - Landesregierung Nordrhein-Westfalen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Große Anfrage 1 der Fraktion BÜNDNIS 90/Die Grünen 101<br />
3 Organisations- und Parteiverbote<br />
3.1 Welches waren die vereinsrechtlichen und verfassungsrechtlichen Voraussetzungen<br />
für Organisationsverbote von Organisationen wie NF, FAP u. a.?<br />
Die genannten Organisationen sind vom Bundesministerium des Innern verboten worden,<br />
weil es sich um Vereine handelte, die länderübergreifend tätig waren (§ 3 Abs. 2 Vereinsgesetz).<br />
In dem Verfahren über den Antrag auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit der „Freiheitlichen<br />
Deutschen Arbeiterpartei“ (Antragsteller: Bundesregierung und Bundesrat) sind die<br />
Anträge vom Bundesverfassungsgericht durch Beschluss vom 17.11.1994 als unzulässig zurückgewiesen<br />
worden (2 BvB 2/93, 2 BvB 3/93). Das Bundesverfassungsgericht hat, ohne<br />
sich mit der inhaltlichen Ausrichtung der Partei im Einzelnen zu befassen, den Parteienstatus<br />
der FAP verneint. Es führt im Einzelnen dazu aus:<br />
„Angesichts ihrer mangelnden Organisationsdichte, einer nicht ausreichend handlungs- und<br />
arbeitsfähigen Parteiorganisation, des geringen Mitgliederbestandes, des fehlenden kontinuierlichen<br />
Hervortretens in der Öffentlichkeit und des Mangels an jeglichem Widerhall in der<br />
Bevölkerung bietet die FAP keine ausreichende Gewähr für die Ernsthaftigkeit ihrer politischen<br />
Zielsetzung. Sie ist keine Partei im Sinne von Art. 21 GG, § 2 Abs. 1 PartG. Das<br />
besondere, wegen der herausgehobenen verfassungsrechtlichen Stellung der politischen<br />
Partei beim Bundesverfassungsgericht monopolisierte, vom allgemeinen Vereinsrecht abweichende<br />
Verbotsverfahren findet deshalb auf sie keine Anwendung.“<br />
Das Bundesministerium des Innern hat als Konsequenz daraus im Jahre 1995 auf der<br />
Grundlage des Art. 9 Abs. 2 GG i. V. m. § 3 des Vereinsgesetzes die „Freiheitliche Deutsche<br />
Arbeiterpartei“ verboten und aufgelöst. Weiterhin wurde verboten, Ersatzorganisationen zu<br />
bilden oder bestehende Organisationen als Ersatzorganisation fortzuführen. Das Vermögen<br />
der FAP wurde beschlagnahmt und eingezogen.<br />
Der Bundesminister des Innern hat mit Verfügung vom 26.11.1992 auf der Grundlage des §<br />
3 des Vereinsgesetzes die „Nationalistische Front“ (NF) verboten und aufgelöst. Anders als<br />
bei der FAP bestand bei der NF kein Zweifel, dass diese Gruppierung nicht den (privilegierenden)<br />
Status einer Partei im Sinne des Art. 21 GG, § 2 Abs. 1 PartG besaß, so dass ein<br />
Verbot auf das allgemeine Vereinsrecht gestützt werden konnte.<br />
3.2 Welches sind im Unterschied hierzu die Voraussetzungen für Parteiverbote<br />
insbesondere unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des BVerfG bei dem<br />
SRP- und KPD-Urteil?<br />
Ein Verein darf dann verboten werden (Art. 9 Abs. 2 GG i. V. m. § 3 VereinsG), wenn durch<br />
Verfügung der Verbotsbehörde festgestellt ist, dass seine Zwecke oder seine Tätigkeit den<br />
Strafgesetzen zuwiderlaufen oder dass er sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder<br />
den Gedanken der Völkerverständigung richtet.<br />
Nach Art. 21 Abs. 2 GG sind Parteien hingegen verfassungswidrig, die nach ihren Zielen oder<br />
nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische<br />
Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik<br />
Deutschland zu gefährden. Parteien genießen wegen ihrer herausgehobenen Stellung einen<br />
besonderen Bestandsschutz.<br />
Die freiheitliche demokratische Grundordnung hat das Bundesverfassungsgericht wie folgt<br />
umschrieben (BVerfGE 2;1, 12f.):<br />
„So lässt sich die freiheitliche demokratische Grundordnung als eine Ordnung<br />
bestimmen, die unter Ausschluss jeglicher Gewalt- und Willkürherrschaft eine rechtsstaatliche<br />
Herrschaftsordnung auf der Grundlage der Selbstbestimmung des Volkes<br />
nach dem Willen der jeweiligen Mehrheit und der Freiheit und Gleichheit darstellt.“<br />
Nach dem Grundgesetz ist allein das Bundesverfassungsgericht autorisiert, eine politische<br />
Partei zu verbieten, Art. 21 Abs. 2 GG (sog. Parteienprivileg).