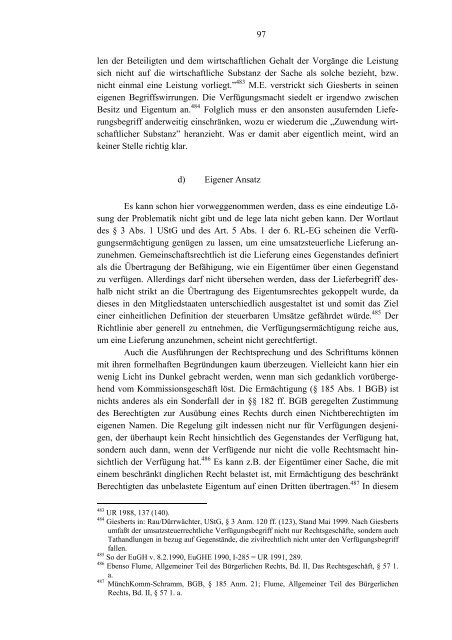Dokument_1.pdf (1165 KB) - OPUS4
Dokument_1.pdf (1165 KB) - OPUS4
Dokument_1.pdf (1165 KB) - OPUS4
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
97<br />
len der Beteiligten und dem wirtschaftlichen Gehalt der Vorgänge die Leistung<br />
sich nicht auf die wirtschaftliche Substanz der Sache als solche bezieht, bzw.<br />
nicht einmal eine Leistung vorliegt.” 483 M.E. verstrickt sich Giesberts in seinen<br />
eigenen Begriffswirrungen. Die Verfügungsmacht siedelt er irgendwo zwischen<br />
Besitz und Eigentum an. 484 Folglich muss er den ansonsten ausufernden Lieferungsbegriff<br />
anderweitig einschränken, wozu er wiederum die „Zuwendung wirtschaftlicher<br />
Substanz” heranzieht. Was er damit aber eigentlich meint, wird an<br />
keiner Stelle richtig klar.<br />
d) Eigener Ansatz<br />
Es kann schon hier vorweggenommen werden, dass es eine eindeutige Lösung<br />
der Problematik nicht gibt und de lege lata nicht geben kann. Der Wortlaut<br />
des § 3 Abs. 1 UStG und des Art. 5 Abs. 1 der 6. RL-EG scheinen die Verfügungsermächtigung<br />
genügen zu lassen, um eine umsatzsteuerliche Lieferung anzunehmen.<br />
Gemeinschaftsrechtlich ist die Lieferung eines Gegenstandes definiert<br />
als die Übertragung der Befähigung, wie ein Eigentümer über einen Gegenstand<br />
zu verfügen. Allerdings darf nicht übersehen werden, dass der Lieferbegriff deshalb<br />
nicht strikt an die Übertragung des Eigentumsrechtes gekoppelt wurde, da<br />
dieses in den Mitgliedstaaten unterschiedlich ausgestaltet ist und somit das Ziel<br />
einer einheitlichen Definition der steuerbaren Umsätze gefährdet würde. 485 Der<br />
Richtlinie aber generell zu entnehmen, die Verfügungsermächtigung reiche aus,<br />
um eine Lieferung anzunehmen, scheint nicht gerechtfertigt.<br />
Auch die Ausführungen der Rechtsprechung und des Schrifttums können<br />
mit ihren formelhaften Begründungen kaum überzeugen. Vielleicht kann hier ein<br />
wenig Licht ins Dunkel gebracht werden, wenn man sich gedanklich vorübergehend<br />
vom Kommissionsgeschäft löst. Die Ermächtigung (§ 185 Abs. 1 BGB) ist<br />
nichts anderes als ein Sonderfall der in §§ 182 ff. BGB geregelten Zustimmung<br />
des Berechtigten zur Ausübung eines Rechts durch einen Nichtberechtigten im<br />
eigenen Namen. Die Regelung gilt indessen nicht nur für Verfügungen desjenigen,<br />
der überhaupt kein Recht hinsichtlich des Gegenstandes der Verfügung hat,<br />
sondern auch dann, wenn der Verfügende nur nicht die volle Rechtsmacht hinsichtlich<br />
der Verfügung hat. 486 Es kann z.B. der Eigentümer einer Sache, die mit<br />
einem beschränkt dinglichen Recht belastet ist, mit Ermächtigung des beschränkt<br />
Berechtigten das unbelastete Eigentum auf einen Dritten übertragen. 487 In diesem<br />
483 UR 1988, 137 (140).<br />
484 Giesberts in: Rau/Dürrwächter, UStG, § 3 Anm. 120 ff. (123), Stand Mai 1999. Nach Giesberts<br />
umfaßt der umsatzsteuerrechtliche Verfügungsbegriff nicht nur Rechtsgeschäfte, sondern auch<br />
Tathandlungen in bezug auf Gegenstände, die zivilrechtlich nicht unter den Verfügungsbegriff<br />
fallen.<br />
485 So der EuGH v. 8.2.1990, EuGHE 1990, I-285 = UR 1991, 289.<br />
486 Ebenso Flume, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Bd. II, Das Rechtsgeschäft, § 57 1.<br />
a.<br />
487 MünchKomm-Schramm, BGB, § 185 Anm. 21; Flume, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen<br />
Rechts, Bd. II, § 57 1. a.