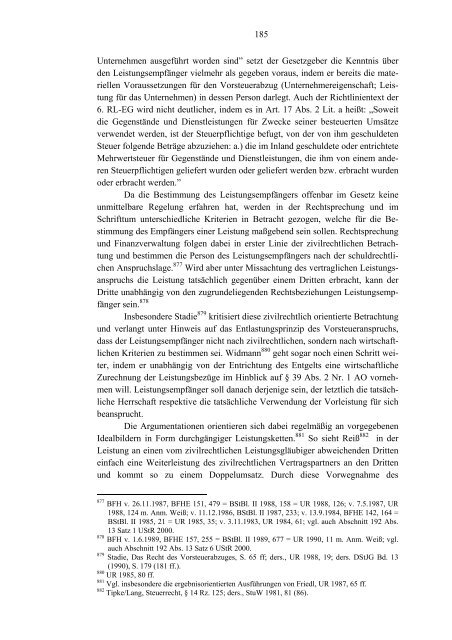Dokument_1.pdf (1165 KB) - OPUS4
Dokument_1.pdf (1165 KB) - OPUS4
Dokument_1.pdf (1165 KB) - OPUS4
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
185<br />
Unternehmen ausgeführt worden sind” setzt der Gesetzgeber die Kenntnis über<br />
den Leistungsempfänger vielmehr als gegeben voraus, indem er bereits die materiellen<br />
Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug (Unternehmereigenschaft; Leistung<br />
für das Unternehmen) in dessen Person darlegt. Auch der Richtlinientext der<br />
6. RL-EG wird nicht deutlicher, indem es in Art. 17 Abs. 2 Lit. a heißt: „Soweit<br />
die Gegenstände und Dienstleistungen für Zwecke seiner besteuerten Umsätze<br />
verwendet werden, ist der Steuerpflichtige befugt, von der von ihm geschuldeten<br />
Steuer folgende Beträge abzuziehen: a.) die im Inland geschuldete oder entrichtete<br />
Mehrwertsteuer für Gegenstände und Dienstleistungen, die ihm von einem anderen<br />
Steuerpflichtigen geliefert wurden oder geliefert werden bzw. erbracht wurden<br />
oder erbracht werden.”<br />
Da die Bestimmung des Leistungsempfängers offenbar im Gesetz keine<br />
unmittelbare Regelung erfahren hat, werden in der Rechtsprechung und im<br />
Schrifttum unterschiedliche Kriterien in Betracht gezogen, welche für die Bestimmung<br />
des Empfängers einer Leistung maßgebend sein sollen. Rechtsprechung<br />
und Finanzverwaltung folgen dabei in erster Linie der zivilrechtlichen Betrachtung<br />
und bestimmen die Person des Leistungsempfängers nach der schuldrechtlichen<br />
Anspruchslage. 877 Wird aber unter Missachtung des vertraglichen Leistungsanspruchs<br />
die Leistung tatsächlich gegenüber einem Dritten erbracht, kann der<br />
Dritte unabhängig von den zugrundeliegenden Rechtsbeziehungen Leistungsempfänger<br />
sein. 878<br />
Insbesondere Stadie 879 kritisiert diese zivilrechtlich orientierte Betrachtung<br />
und verlangt unter Hinweis auf das Entlastungsprinzip des Vorsteueranspruchs,<br />
dass der Leistungsempfänger nicht nach zivilrechtlichen, sondern nach wirtschaftlichen<br />
Kriterien zu bestimmen sei. Widmann 880 geht sogar noch einen Schritt weiter,<br />
indem er unabhängig von der Entrichtung des Entgelts eine wirtschaftliche<br />
Zurechnung der Leistungsbezüge im Hinblick auf § 39 Abs. 2 Nr. 1 AO vornehmen<br />
will. Leistungsempfänger soll danach derjenige sein, der letztlich die tatsächliche<br />
Herrschaft respektive die tatsächliche Verwendung der Vorleistung für sich<br />
beansprucht.<br />
Die Argumentationen orientieren sich dabei regelmäßig an vorgegebenen<br />
Idealbildern in Form durchgängiger Leistungsketten. 881 So sieht Reiß 882 in der<br />
Leistung an einen vom zivilrechtlichen Leistungsgläubiger abweichenden Dritten<br />
einfach eine Weiterleistung des zivilrechtlichen Vertragspartners an den Dritten<br />
und kommt so zu einem Doppelumsatz. Durch diese Vorwegnahme des<br />
877 BFH v. 26.11.1987, BFHE 151, 479 = BStBl. II 1988, 158 = UR 1988, 126; v. 7.5.1987, UR<br />
1988, 124 m. Anm. Weiß; v. 11.12.1986, BStBl. II 1987, 233; v. 13.9.1984, BFHE 142, 164 =<br />
BStBl. II 1985, 21 = UR 1985, 35; v. 3.11.1983, UR 1984, 61; vgl. auch Abschnitt 192 Abs.<br />
13 Satz 1 UStR 2000.<br />
878 BFH v. 1.6.1989, BFHE 157, 255 = BStBl. II 1989, 677 = UR 1990, 11 m. Anm. Weiß; vgl.<br />
auch Abschnitt 192 Abs. 13 Satz 6 UStR 2000.<br />
879 Stadie, Das Recht des Vorsteuerabzuges, S. 65 ff; ders., UR 1988, 19; ders. DStJG Bd. 13<br />
(1990), S. 179 (181 ff.).<br />
880 UR 1985, 80 ff.<br />
881 Vgl. insbesondere die ergebnisorientierten Ausführungen von Friedl, UR 1987, 65 ff.<br />
882 Tipke/Lang, Steuerrecht, § 14 Rz. 125; ders., StuW 1981, 81 (86).