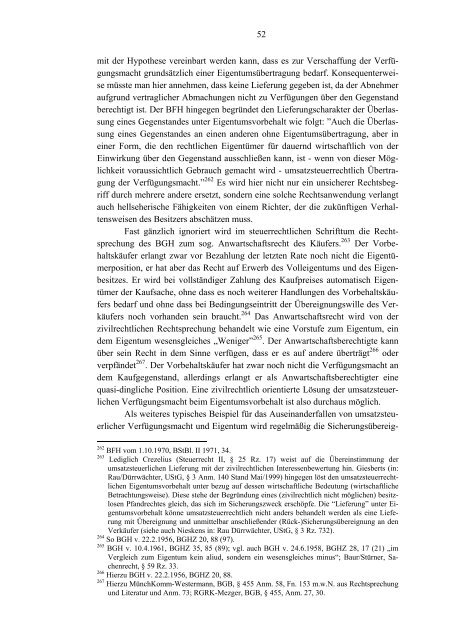Dokument_1.pdf (1165 KB) - OPUS4
Dokument_1.pdf (1165 KB) - OPUS4
Dokument_1.pdf (1165 KB) - OPUS4
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
52<br />
mit der Hypothese vereinbart werden kann, dass es zur Verschaffung der Verfügungsmacht<br />
grundsätzlich einer Eigentumsübertragung bedarf. Konsequenterweise<br />
müsste man hier annehmen, dass keine Lieferung gegeben ist, da der Abnehmer<br />
aufgrund vertraglicher Abmachungen nicht zu Verfügungen über den Gegenstand<br />
berechtigt ist. Der BFH hingegen begründet den Lieferungscharakter der Überlassung<br />
eines Gegenstandes unter Eigentumsvorbehalt wie folgt: ”Auch die Überlassung<br />
eines Gegenstandes an einen anderen ohne Eigentumsübertragung, aber in<br />
einer Form, die den rechtlichen Eigentümer für dauernd wirtschaftlich von der<br />
Einwirkung über den Gegenstand ausschließen kann, ist - wenn von dieser Möglichkeit<br />
voraussichtlich Gebrauch gemacht wird - umsatzsteuerrechtlich Übertragung<br />
der Verfügungsmacht.” 262 Es wird hier nicht nur ein unsicherer Rechtsbegriff<br />
durch mehrere andere ersetzt, sondern eine solche Rechtsanwendung verlangt<br />
auch hellseherische Fähigkeiten von einem Richter, der die zukünftigen Verhaltensweisen<br />
des Besitzers abschätzen muss.<br />
Fast gänzlich ignoriert wird im steuerrechtlichen Schrifttum die Rechtsprechung<br />
des BGH zum sog. Anwartschaftsrecht des Käufers. 263 Der Vorbehaltskäufer<br />
erlangt zwar vor Bezahlung der letzten Rate noch nicht die Eigentümerposition,<br />
er hat aber das Recht auf Erwerb des Volleigentums und des Eigenbesitzes.<br />
Er wird bei vollständiger Zahlung des Kaufpreises automatisch Eigentümer<br />
der Kaufsache, ohne dass es noch weiterer Handlungen des Vorbehaltskäufers<br />
bedarf und ohne dass bei Bedingungseintritt der Übereignungswille des Verkäufers<br />
noch vorhanden sein braucht. 264 Das Anwartschaftsrecht wird von der<br />
zivilrechtlichen Rechtsprechung behandelt wie eine Vorstufe zum Eigentum, ein<br />
dem Eigentum wesensgleiches „Weniger” 265 . Der Anwartschaftsberechtigte kann<br />
über sein Recht in dem Sinne verfügen, dass er es auf andere überträgt 266 oder<br />
verpfändet 267 . Der Vorbehaltskäufer hat zwar noch nicht die Verfügungsmacht an<br />
dem Kaufgegenstand, allerdings erlangt er als Anwartschaftsberechtigter eine<br />
quasi-dingliche Position. Eine zivilrechtlich orientierte Lösung der umsatzsteuerlichen<br />
Verfügungsmacht beim Eigentumsvorbehalt ist also durchaus möglich.<br />
Als weiteres typisches Beispiel für das Auseinanderfallen von umsatzsteuerlicher<br />
Verfügungsmacht und Eigentum wird regelmäßig die Sicherungsübereig-<br />
262 BFH vom 1.10.1970, BStBl. II 1971, 34.<br />
263 Lediglich Crezelius (Steuerrecht II, § 25 Rz. 17) weist auf die Übereinstimmung der<br />
umsatzsteuerlichen Lieferung mit der zivilrechtlichen Interessenbewertung hin. Giesberts (in:<br />
Rau/Dürrwächter, UStG, § 3 Anm. 140 Stand Mai/1999) hingegen löst den umsatzsteuerrechtlichen<br />
Eigentumsvorbehalt unter bezug auf dessen wirtschaftliche Bedeutung (wirtschaftliche<br />
Betrachtungsweise). Diese stehe der Begründung eines (zivilrechtlich nicht möglichen) besitzlosen<br />
Pfandrechtes gleich, das sich im Sicherungszweck erschöpfe. Die “Lieferung” unter Eigentumsvorbehalt<br />
könne umsatzsteuerrechtlich nicht anders behandelt werden als eine Lieferung<br />
mit Übereignung und unmittelbar anschließender (Rück-)Sicherungsübereignung an den<br />
Verkäufer (siehe auch Nieskens in: Rau Dürrwächter, UStG, § 3 Rz. 732).<br />
264 So BGH v. 22.2.1956, BGHZ 20, 88 (97).<br />
265 BGH v. 10.4.1961, BGHZ 35, 85 (89); vgl. auch BGH v. 24.6.1958, BGHZ 28, 17 (21) „im<br />
Vergleich zum Eigentum kein aliud, sondern ein wesensgleiches minus“; Baur/Stürner, Sachenrecht,<br />
§ 59 Rz. 33.<br />
266 Hierzu BGH v. 22.2.1956, BGHZ 20, 88.<br />
267 Hierzu MünchKomm-Westermann, BGB, § 455 Anm. 58, Fn. 153 m.w.N. aus Rechtsprechung<br />
und Literatur und Anm. 73; RGRK-Mezger, BGB, § 455, Anm. 27, 30.