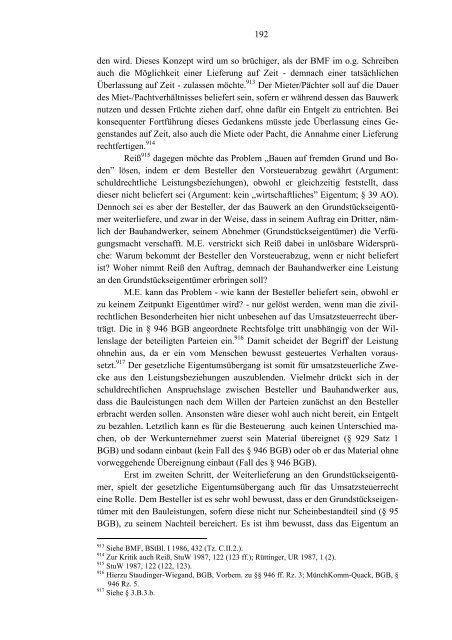Dokument_1.pdf (1165 KB) - OPUS4
Dokument_1.pdf (1165 KB) - OPUS4
Dokument_1.pdf (1165 KB) - OPUS4
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
192<br />
den wird. Dieses Konzept wird um so brüchiger, als der BMF im o.g. Schreiben<br />
auch die Möglichkeit einer Lieferung auf Zeit - demnach einer tatsächlichen<br />
Überlassung auf Zeit - zulassen möchte. 913 Der Mieter/Pächter soll auf die Dauer<br />
des Miet-/Pachtverhältnisses beliefert sein, sofern er während dessen das Bauwerk<br />
nutzen und dessen Früchte ziehen darf, ohne dafür ein Entgelt zu entrichten. Bei<br />
konsequenter Fortführung dieses Gedankens müsste jede Überlassung eines Gegenstandes<br />
auf Zeit, also auch die Miete oder Pacht, die Annahme einer Lieferung<br />
rechtfertigen. 914<br />
Reiß 915 dagegen möchte das Problem „Bauen auf fremden Grund und Boden”<br />
lösen, indem er dem Besteller den Vorsteuerabzug gewährt (Argument:<br />
schuldrechtliche Leistungsbeziehungen), obwohl er gleichzeitig feststellt, dass<br />
dieser nicht beliefert sei (Argument: kein „wirtschaftliches” Eigentum; § 39 AO).<br />
Dennoch sei es aber der Besteller, der das Bauwerk an den Grundstückseigentümer<br />
weiterliefere, und zwar in der Weise, dass in seinem Auftrag ein Dritter, nämlich<br />
der Bauhandwerker, seinem Abnehmer (Grundstückseigentümer) die Verfügungsmacht<br />
verschafft. M.E. verstrickt sich Reiß dabei in unlösbare Widersprüche:<br />
Warum bekommt der Besteller den Vorsteuerabzug, wenn er nicht beliefert<br />
ist? Woher nimmt Reiß den Auftrag, demnach der Bauhandwerker eine Leistung<br />
an den Grundstückseigentümer erbringen soll?<br />
M.E. kann das Problem - wie kann der Besteller beliefert sein, obwohl er<br />
zu keinem Zeitpunkt Eigentümer wird? - nur gelöst werden, wenn man die zivilrechtlichen<br />
Besonderheiten hier nicht unbesehen auf das Umsatzsteuerrecht überträgt.<br />
Die in § 946 BGB angeordnete Rechtsfolge tritt unabhängig von der Willenslage<br />
der beteiligten Parteien ein. 916 Damit scheidet der Begriff der Leistung<br />
ohnehin aus, da er ein vom Menschen bewusst gesteuertes Verhalten voraussetzt.<br />
917 Der gesetzliche Eigentumsübergang ist somit für umsatzsteuerliche Zwecke<br />
aus den Leistungsbeziehungen auszublenden. Vielmehr drückt sich in der<br />
schuldrechtlichen Anspruchslage zwischen Besteller und Bauhandwerker aus,<br />
dass die Bauleistungen nach dem Willen der Parteien zunächst an den Besteller<br />
erbracht werden sollen. Ansonsten wäre dieser wohl auch nicht bereit, ein Entgelt<br />
zu bezahlen. Letztlich kann es für die Besteuerung auch keinen Unterschied machen,<br />
ob der Werkunternehmer zuerst sein Material übereignet (§ 929 Satz 1<br />
BGB) und sodann einbaut (kein Fall des § 946 BGB) oder ob er das Material ohne<br />
vorweggehende Übereignung einbaut (Fall des § 946 BGB).<br />
Erst im zweiten Schritt, der Weiterlieferung an den Grundstückseigentümer,<br />
spielt der gesetzliche Eigentumsübergang auch für das Umsatzsteuerrecht<br />
eine Rolle. Dem Besteller ist es sehr wohl bewusst, dass er den Grundstückseigentümer<br />
mit den Bauleistungen, sofern diese nicht nur Scheinbestandteil sind (§ 95<br />
BGB), zu seinem Nachteil bereichert. Es ist ihm bewusst, dass das Eigentum an<br />
913 Siehe BMF, BStBl. I 1986, 432 (Tz. C.II.2.).<br />
914 Zur Kritik auch Reiß, StuW 1987, 122 (123 ff.); Rüttinger, UR 1987, 1 (2).<br />
915 StuW 1987, 122 (122, 123).<br />
916 Hierzu Staudinger-Wiegand, BGB, Vorbem. zu §§ 946 ff. Rz. 3; MünchKomm-Quack, BGB, §<br />
946 Rz. 5.<br />
917 Siehe § 3.B.3.b.