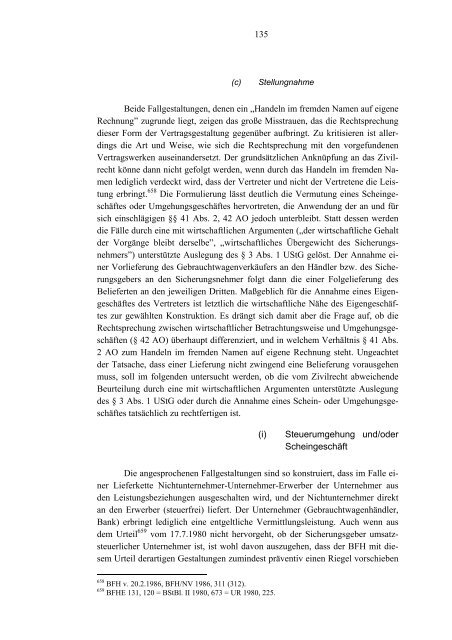Dokument_1.pdf (1165 KB) - OPUS4
Dokument_1.pdf (1165 KB) - OPUS4
Dokument_1.pdf (1165 KB) - OPUS4
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
135<br />
(c)<br />
Stellungnahme<br />
Beide Fallgestaltungen, denen ein „Handeln im fremden Namen auf eigene<br />
Rechnung” zugrunde liegt, zeigen das große Misstrauen, das die Rechtsprechung<br />
dieser Form der Vertragsgestaltung gegenüber aufbringt. Zu kritisieren ist allerdings<br />
die Art und Weise, wie sich die Rechtsprechung mit den vorgefundenen<br />
Vertragswerken auseinandersetzt. Der grundsätzlichen Anknüpfung an das Zivilrecht<br />
könne dann nicht gefolgt werden, wenn durch das Handeln im fremden Namen<br />
lediglich verdeckt wird, dass der Vertreter und nicht der Vertretene die Leistung<br />
erbringt. 658 Die Formulierung lässt deutlich die Vermutung eines Scheingeschäftes<br />
oder Umgehungsgeschäftes hervortreten, die Anwendung der an und für<br />
sich einschlägigen §§ 41 Abs. 2, 42 AO jedoch unterbleibt. Statt dessen werden<br />
die Fälle durch eine mit wirtschaftlichen Argumenten („der wirtschaftliche Gehalt<br />
der Vorgänge bleibt derselbe”, „wirtschaftliches Übergewicht des Sicherungsnehmers”)<br />
unterstützte Auslegung des § 3 Abs. 1 UStG gelöst. Der Annahme einer<br />
Vorlieferung des Gebrauchtwagenverkäufers an den Händler bzw. des Sicherungsgebers<br />
an den Sicherungsnehmer folgt dann die einer Folgelieferung des<br />
Belieferten an den jeweiligen Dritten. Maßgeblich für die Annahme eines Eigengeschäftes<br />
des Vertreters ist letztlich die wirtschaftliche Nähe des Eigengeschäftes<br />
zur gewählten Konstruktion. Es drängt sich damit aber die Frage auf, ob die<br />
Rechtsprechung zwischen wirtschaftlicher Betrachtungsweise und Umgehungsgeschäften<br />
(§ 42 AO) überhaupt differenziert, und in welchem Verhältnis § 41 Abs.<br />
2 AO zum Handeln im fremden Namen auf eigene Rechnung steht. Ungeachtet<br />
der Tatsache, dass einer Lieferung nicht zwingend eine Belieferung vorausgehen<br />
muss, soll im folgenden untersucht werden, ob die vom Zivilrecht abweichende<br />
Beurteilung durch eine mit wirtschaftlichen Argumenten unterstützte Auslegung<br />
des § 3 Abs. 1 UStG oder durch die Annahme eines Schein- oder Umgehungsgeschäftes<br />
tatsächlich zu rechtfertigen ist.<br />
(i)<br />
Steuerumgehung und/oder<br />
Scheingeschäft<br />
Die angesprochenen Fallgestaltungen sind so konstruiert, dass im Falle einer<br />
Lieferkette Nichtunternehmer-Unternehmer-Erwerber der Unternehmer aus<br />
den Leistungsbeziehungen ausgeschalten wird, und der Nichtunternehmer direkt<br />
an den Erwerber (steuerfrei) liefert. Der Unternehmer (Gebrauchtwagenhändler,<br />
Bank) erbringt lediglich eine entgeltliche Vermittlungsleistung. Auch wenn aus<br />
dem Urteil 659 vom 17.7.1980 nicht hervorgeht, ob der Sicherungsgeber umsatzsteuerlicher<br />
Unternehmer ist, ist wohl davon auszugehen, dass der BFH mit diesem<br />
Urteil derartigen Gestaltungen zumindest präventiv einen Riegel vorschieben<br />
658 BFH v. 20.2.1986, BFH/NV 1986, 311 (312).<br />
659 BFHE 131, 120 = BStBl. II 1980, 673 = UR 1980, 225.