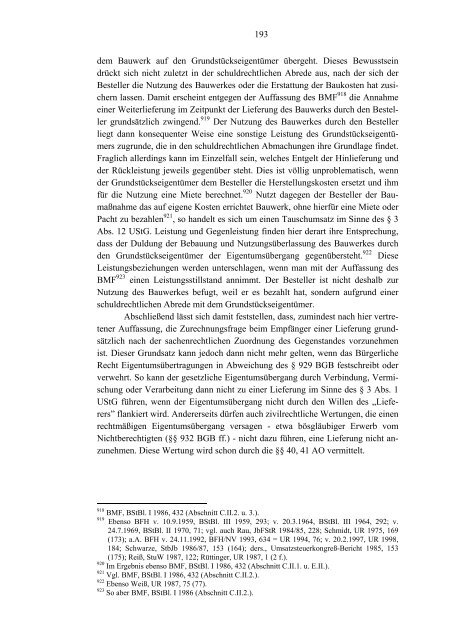Dokument_1.pdf (1165 KB) - OPUS4
Dokument_1.pdf (1165 KB) - OPUS4
Dokument_1.pdf (1165 KB) - OPUS4
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
193<br />
dem Bauwerk auf den Grundstückseigentümer übergeht. Dieses Bewusstsein<br />
drückt sich nicht zuletzt in der schuldrechtlichen Abrede aus, nach der sich der<br />
Besteller die Nutzung des Bauwerkes oder die Erstattung der Baukosten hat zusichern<br />
lassen. Damit erscheint entgegen der Auffassung des BMF 918 die Annahme<br />
einer Weiterlieferung im Zeitpunkt der Lieferung des Bauwerks durch den Besteller<br />
grundsätzlich zwingend. 919 Der Nutzung des Bauwerkes durch den Besteller<br />
liegt dann konsequenter Weise eine sonstige Leistung des Grundstückseigentümers<br />
zugrunde, die in den schuldrechtlichen Abmachungen ihre Grundlage findet.<br />
Fraglich allerdings kann im Einzelfall sein, welches Entgelt der Hinlieferung und<br />
der Rückleistung jeweils gegenüber steht. Dies ist völlig unproblematisch, wenn<br />
der Grundstückseigentümer dem Besteller die Herstellungskosten ersetzt und ihm<br />
für die Nutzung eine Miete berechnet. 920 Nutzt dagegen der Besteller der Baumaßnahme<br />
das auf eigene Kosten errichtet Bauwerk, ohne hierfür eine Miete oder<br />
Pacht zu bezahlen 921 , so handelt es sich um einen Tauschumsatz im Sinne des § 3<br />
Abs. 12 UStG. Leistung und Gegenleistung finden hier derart ihre Entsprechung,<br />
dass der Duldung der Bebauung und Nutzungsüberlassung des Bauwerkes durch<br />
den Grundstückseigentümer der Eigentumsübergang gegenübersteht. 922 Diese<br />
Leistungsbeziehungen werden unterschlagen, wenn man mit der Auffassung des<br />
BMF 923 einen Leistungsstillstand annimmt. Der Besteller ist nicht deshalb zur<br />
Nutzung des Bauwerkes befugt, weil er es bezahlt hat, sondern aufgrund einer<br />
schuldrechtlichen Abrede mit dem Grundstückseigentümer.<br />
Abschließend lässt sich damit feststellen, dass, zumindest nach hier vertretener<br />
Auffassung, die Zurechnungsfrage beim Empfänger einer Lieferung grundsätzlich<br />
nach der sachenrechtlichen Zuordnung des Gegenstandes vorzunehmen<br />
ist. Dieser Grundsatz kann jedoch dann nicht mehr gelten, wenn das Bürgerliche<br />
Recht Eigentumsübertragungen in Abweichung des § 929 BGB festschreibt oder<br />
verwehrt. So kann der gesetzliche Eigentumsübergang durch Verbindung, Vermischung<br />
oder Verarbeitung dann nicht zu einer Lieferung im Sinne des § 3 Abs. 1<br />
UStG führen, wenn der Eigentumsübergang nicht durch den Willen des „Lieferers”<br />
flankiert wird. Andererseits dürfen auch zivilrechtliche Wertungen, die einen<br />
rechtmäßigen Eigentumsübergang versagen - etwa bösgläubiger Erwerb vom<br />
Nichtberechtigten (§§ 932 BGB ff.) - nicht dazu führen, eine Lieferung nicht anzunehmen.<br />
Diese Wertung wird schon durch die §§ 40, 41 AO vermittelt.<br />
918 BMF, BStBl. I 1986, 432 (Abschnitt C.II.2. u. 3.).<br />
919 Ebenso BFH v. 10.9.1959, BStBl. III 1959, 293; v. 20.3.1964, BStBl. III 1964, 292; v.<br />
24.7.1969, BStBl. II 1970, 71; vgl. auch Rau, JbFStR 1984/85, 228; Schmidt, UR 1975, 169<br />
(173); a.A. BFH v. 24.11.1992, BFH/NV 1993, 634 = UR 1994, 76; v. 20.2.1997, UR 1998,<br />
184; Schwarze, StbJb 1986/87, 153 (164); ders., Umsatzsteuerkongreß-Bericht 1985, 153<br />
(175); Reiß, StuW 1987, 122; Rüttinger, UR 1987, 1 (2 f.).<br />
920 Im Ergebnis ebenso BMF, BStBl. I 1986, 432 (Abschnitt C.II.1. u. E.II.).<br />
921 Vgl. BMF, BStBl. I 1986, 432 (Abschnitt C.II.2.).<br />
922 Ebenso Weiß, UR 1987, 75 (77).<br />
923 So aber BMF, BStBl. I 1986 (Abschnitt C.II.2.).