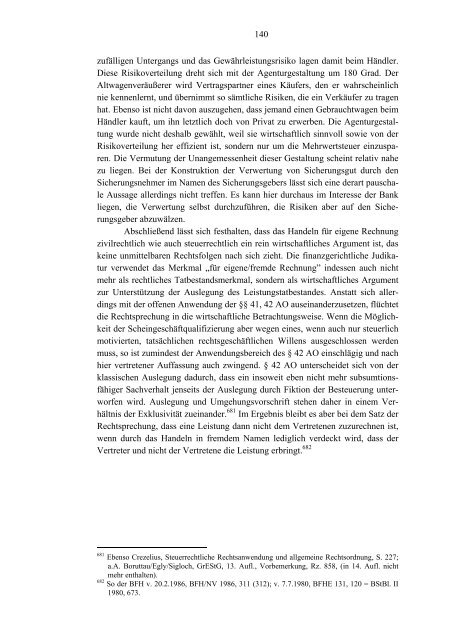Dokument_1.pdf (1165 KB) - OPUS4
Dokument_1.pdf (1165 KB) - OPUS4
Dokument_1.pdf (1165 KB) - OPUS4
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
140<br />
zufälligen Untergangs und das Gewährleistungsrisiko lagen damit beim Händler.<br />
Diese Risikoverteilung dreht sich mit der Agenturgestaltung um 180 Grad. Der<br />
Altwagenveräußerer wird Vertragspartner eines Käufers, den er wahrscheinlich<br />
nie kennenlernt, und übernimmt so sämtliche Risiken, die ein Verkäufer zu tragen<br />
hat. Ebenso ist nicht davon auszugehen, dass jemand einen Gebrauchtwagen beim<br />
Händler kauft, um ihn letztlich doch von Privat zu erwerben. Die Agenturgestaltung<br />
wurde nicht deshalb gewählt, weil sie wirtschaftlich sinnvoll sowie von der<br />
Risikoverteilung her effizient ist, sondern nur um die Mehrwertsteuer einzusparen.<br />
Die Vermutung der Unangemessenheit dieser Gestaltung scheint relativ nahe<br />
zu liegen. Bei der Konstruktion der Verwertung von Sicherungsgut durch den<br />
Sicherungsnehmer im Namen des Sicherungsgebers lässt sich eine derart pauschale<br />
Aussage allerdings nicht treffen. Es kann hier durchaus im Interesse der Bank<br />
liegen, die Verwertung selbst durchzuführen, die Risiken aber auf den Sicherungsgeber<br />
abzuwälzen.<br />
Abschließend lässt sich festhalten, dass das Handeln für eigene Rechnung<br />
zivilrechtlich wie auch steuerrechtlich ein rein wirtschaftliches Argument ist, das<br />
keine unmittelbaren Rechtsfolgen nach sich zieht. Die finanzgerichtliche Judikatur<br />
verwendet das Merkmal „für eigene/fremde Rechnung” indessen auch nicht<br />
mehr als rechtliches Tatbestandsmerkmal, sondern als wirtschaftliches Argument<br />
zur Unterstützung der Auslegung des Leistungstatbestandes. Anstatt sich allerdings<br />
mit der offenen Anwendung der §§ 41, 42 AO auseinanderzusetzen, flüchtet<br />
die Rechtsprechung in die wirtschaftliche Betrachtungsweise. Wenn die Möglichkeit<br />
der Scheingeschäftqualifizierung aber wegen eines, wenn auch nur steuerlich<br />
motivierten, tatsächlichen rechtsgeschäftlichen Willens ausgeschlossen werden<br />
muss, so ist zumindest der Anwendungsbereich des § 42 AO einschlägig und nach<br />
hier vertretener Auffassung auch zwingend. § 42 AO unterscheidet sich von der<br />
klassischen Auslegung dadurch, dass ein insoweit eben nicht mehr subsumtionsfähiger<br />
Sachverhalt jenseits der Auslegung durch Fiktion der Besteuerung unterworfen<br />
wird. Auslegung und Umgehungsvorschrift stehen daher in einem Verhältnis<br />
der Exklusivität zueinander. 681 Im Ergebnis bleibt es aber bei dem Satz der<br />
Rechtsprechung, dass eine Leistung dann nicht dem Vertretenen zuzurechnen ist,<br />
wenn durch das Handeln in fremdem Namen lediglich verdeckt wird, dass der<br />
Vertreter und nicht der Vertretene die Leistung erbringt. 682<br />
681 Ebenso Crezelius, Steuerrechtliche Rechtsanwendung und allgemeine Rechtsordnung, S. 227;<br />
a.A. Boruttau/Egly/Sigloch, GrEStG, 13. Aufl., Vorbemerkung, Rz. 858, (in 14. Aufl. nicht<br />
mehr enthalten).<br />
682 So der BFH v. 20.2.1986, BFH/NV 1986, 311 (312); v. 7.7.1980, BFHE 131, 120 = BStBl. II<br />
1980, 673.