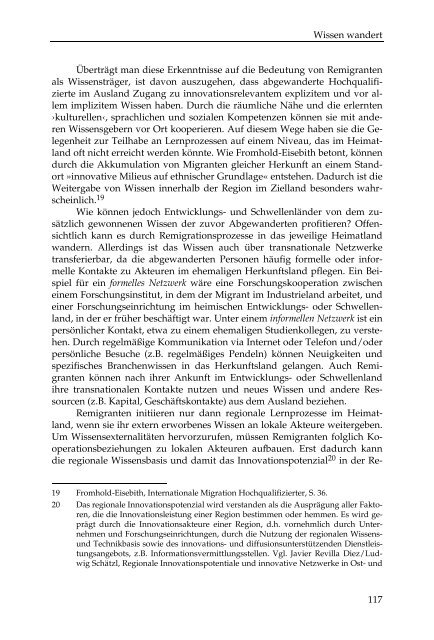Heft 42 - IMIS - Universität Osnabrück
Heft 42 - IMIS - Universität Osnabrück
Heft 42 - IMIS - Universität Osnabrück
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Wissen wandert<br />
Überträgt man diese Erkenntnisse auf die Bedeutung von Remigranten<br />
als Wissensträger, ist davon auszugehen, dass abgewanderte Hochqualifizierte<br />
im Ausland Zugang zu innovationsrelevantem explizitem und vor allem<br />
implizitem Wissen haben. Durch die räumliche Nähe und die erlernten<br />
›kulturellen‹, sprachlichen und sozialen Kompetenzen können sie mit anderen<br />
Wissensgebern vor Ort kooperieren. Auf diesem Wege haben sie die Gelegenheit<br />
zur Teilhabe an Lernprozessen auf einem Niveau, das im Heimatland<br />
oft nicht erreicht werden könnte. Wie Fromhold-Eisebith betont, können<br />
durch die Akkumulation von Migranten gleicher Herkunft an einem Standort<br />
»innovative Milieus auf ethnischer Grundlage« entstehen. Dadurch ist die<br />
Weitergabe von Wissen innerhalb der Region im Zielland besonders wahrscheinlich.<br />
19<br />
Wie können jedoch Entwicklungs- und Schwellenländer von dem zusätzlich<br />
gewonnenen Wissen der zuvor Abgewanderten profitieren? Offensichtlich<br />
kann es durch Remigrationsprozesse in das jeweilige Heimatland<br />
wandern. Allerdings ist das Wissen auch über transnationale Netzwerke<br />
transferierbar, da die abgewanderten Personen häufig formelle oder informelle<br />
Kontakte zu Akteuren im ehemaligen Herkunftsland pflegen. Ein Beispiel<br />
für ein formelles Netzwerk wäre eine Forschungskooperation zwischen<br />
einem Forschungsinstitut, in dem der Migrant im Industrieland arbeitet, und<br />
einer Forschungseinrichtung im heimischen Entwicklungs- oder Schwellenland,<br />
in der er früher beschäftigt war. Unter einem informellen Netzwerk ist ein<br />
persönlicher Kontakt, etwa zu einem ehemaligen Studienkollegen, zu verstehen.<br />
Durch regelmäßige Kommunikation via Internet oder Telefon und/oder<br />
persönliche Besuche (z.B. regelmäßiges Pendeln) können Neuigkeiten und<br />
spezifisches Branchenwissen in das Herkunftsland gelangen. Auch Remigranten<br />
können nach ihrer Ankunft im Entwicklungs- oder Schwellenland<br />
ihre transnationalen Kontakte nutzen und neues Wissen und andere Ressourcen<br />
(z.B. Kapital, Geschäftskontakte) aus dem Ausland beziehen.<br />
Remigranten initiieren nur dann regionale Lernprozesse im Heimatland,<br />
wenn sie ihr extern erworbenes Wissen an lokale Akteure weitergeben.<br />
Um Wissensexternalitäten hervorzurufen, müssen Remigranten folglich Kooperationsbeziehungen<br />
zu lokalen Akteuren aufbauen. Erst dadurch kann<br />
die regionale Wissensbasis und damit das Innovationspotenzial 20 in der Re-<br />
19 Fromhold-Eisebith, Internationale Migration Hochqualifizierter, S. 36.<br />
20 Das regionale Innovationspotenzial wird verstanden als die Ausprägung aller Faktoren,<br />
die die Innovationsleistung einer Region bestimmen oder hemmen. Es wird geprägt<br />
durch die Innovationsakteure einer Region, d.h. vornehmlich durch Unternehmen<br />
und Forschungseinrichtungen, durch die Nutzung der regionalen Wissensund<br />
Technikbasis sowie des innovations- und diffusionsunterstützenden Dienstleistungsangebots,<br />
z.B. Informationsvermittlungsstellen. Vgl. Javier Revilla Diez/Ludwig<br />
Schätzl, Regionale Innovationspotentiale und innovative Netzwerke in Ost- und<br />
117