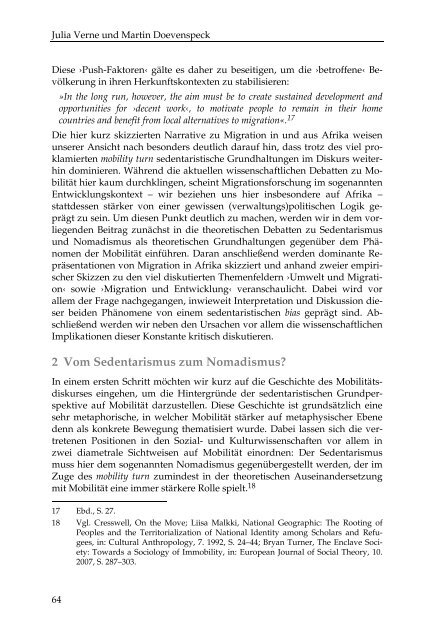Heft 42 - IMIS - Universität Osnabrück
Heft 42 - IMIS - Universität Osnabrück
Heft 42 - IMIS - Universität Osnabrück
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Julia Verne und Martin Doevenspeck<br />
Diese ›Push-Faktoren‹ gälte es daher zu beseitigen, um die ›betroffene‹ Bevölkerung<br />
in ihren Herkunftskontexten zu stabilisieren:<br />
»In the long run, however, the aim must be to create sustained development and<br />
opportunities for ›decent work‹, to motivate people to remain in their home<br />
countries and benefit from local alternatives to migration«. 17<br />
Die hier kurz skizzierten Narrative zu Migration in und aus Afrika weisen<br />
unserer Ansicht nach besonders deutlich darauf hin, dass trotz des viel proklamierten<br />
mobility turn sedentaristische Grundhaltungen im Diskurs weiterhin<br />
dominieren. Während die aktuellen wissenschaftlichen Debatten zu Mobilität<br />
hier kaum durchklingen, scheint Migrationsforschung im sogenannten<br />
Entwicklungskontext – wir beziehen uns hier insbesondere auf Afrika –<br />
stattdessen stärker von einer gewissen (verwaltungs)politischen Logik geprägt<br />
zu sein. Um diesen Punkt deutlich zu machen, werden wir in dem vorliegenden<br />
Beitrag zunächst in die theoretischen Debatten zu Sedentarismus<br />
und Nomadismus als theoretischen Grundhaltungen gegenüber dem Phänomen<br />
der Mobilität einführen. Daran anschließend werden dominante Repräsentationen<br />
von Migration in Afrika skizziert und anhand zweier empirischer<br />
Skizzen zu den viel diskutierten Themenfeldern ›Umwelt und Migration‹<br />
sowie ›Migration und Entwicklung‹ veranschaulicht. Dabei wird vor<br />
allem der Frage nachgegangen, inwieweit Interpretation und Diskussion dieser<br />
beiden Phänomene von einem sedentaristischen bias geprägt sind. Abschließend<br />
werden wir neben den Ursachen vor allem die wissenschaftlichen<br />
Implikationen dieser Konstante kritisch diskutieren.<br />
2 Vom Sedentarismus zum Nomadismus?<br />
In einem ersten Schritt möchten wir kurz auf die Geschichte des Mobilitätsdiskurses<br />
eingehen, um die Hintergründe der sedentaristischen Grundperspektive<br />
auf Mobilität darzustellen. Diese Geschichte ist grundsätzlich eine<br />
sehr metaphorische, in welcher Mobilität stärker auf metaphysischer Ebene<br />
denn als konkrete Bewegung thematisiert wurde. Dabei lassen sich die vertretenen<br />
Positionen in den Sozial- und Kulturwissenschaften vor allem in<br />
zwei diametrale Sichtweisen auf Mobilität einordnen: Der Sedentarismus<br />
muss hier dem sogenannten Nomadismus gegenübergestellt werden, der im<br />
Zuge des mobility turn zumindest in der theoretischen Auseinandersetzung<br />
mit Mobilität eine immer stärkere Rolle spielt. 18<br />
17 Ebd., S. 27.<br />
18 Vgl. Cresswell, On the Move; Liisa Malkki, National Geographic: The Rooting of<br />
Peoples and the Territorialization of National Identity among Scholars and Refugees,<br />
in: Cultural Anthropology, 7. 1992, S. 24–44; Bryan Turner, The Enclave Society:<br />
Towards a Sociology of Immobility, in: European Journal of Social Theory, 10.<br />
2007, S. 287–303.<br />
64