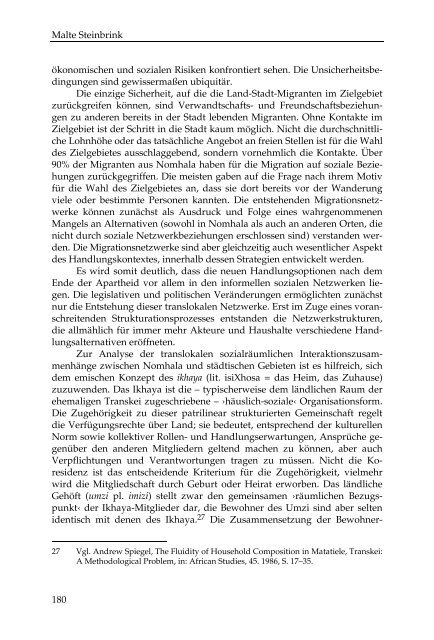Heft 42 - IMIS - Universität Osnabrück
Heft 42 - IMIS - Universität Osnabrück
Heft 42 - IMIS - Universität Osnabrück
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Malte Steinbrink<br />
ökonomischen und sozialen Risiken konfrontiert sehen. Die Unsicherheitsbedingungen<br />
sind gewissermaßen ubiquitär.<br />
Die einzige Sicherheit, auf die die Land-Stadt-Migranten im Zielgebiet<br />
zurückgreifen können, sind Verwandtschafts- und Freundschaftsbeziehungen<br />
zu anderen bereits in der Stadt lebenden Migranten. Ohne Kontakte im<br />
Zielgebiet ist der Schritt in die Stadt kaum möglich. Nicht die durchschnittliche<br />
Lohnhöhe oder das tatsächliche Angebot an freien Stellen ist für die Wahl<br />
des Zielgebietes ausschlaggebend, sondern vornehmlich die Kontakte. Über<br />
90% der Migranten aus Nomhala haben für die Migration auf soziale Beziehungen<br />
zurückgegriffen. Die meisten gaben auf die Frage nach ihrem Motiv<br />
für die Wahl des Zielgebietes an, dass sie dort bereits vor der Wanderung<br />
viele oder bestimmte Personen kannten. Die entstehenden Migrationsnetzwerke<br />
können zunächst als Ausdruck und Folge eines wahrgenommenen<br />
Mangels an Alternativen (sowohl in Nomhala als auch an anderen Orten, die<br />
nicht durch soziale Netzwerkbeziehungen erschlossen sind) verstanden werden.<br />
Die Migrationsnetzwerke sind aber gleichzeitig auch wesentlicher Aspekt<br />
des Handlungskontextes, innerhalb dessen Strategien entwickelt werden.<br />
Es wird somit deutlich, dass die neuen Handlungsoptionen nach dem<br />
Ende der Apartheid vor allem in den informellen sozialen Netzwerken liegen.<br />
Die legislativen und politischen Veränderungen ermöglichten zunächst<br />
nur die Entstehung dieser translokalen Netzwerke. Erst im Zuge eines voranschreitenden<br />
Strukturationsprozesses entstanden die Netzwerkstrukturen,<br />
die allmählich für immer mehr Akteure und Haushalte verschiedene Handlungsalternativen<br />
eröffneten.<br />
Zur Analyse der translokalen sozialräumlichen Interaktionszusammenhänge<br />
zwischen Nomhala und städtischen Gebieten ist es hilfreich, sich<br />
dem emischen Konzept des ikhaya (lit. isiXhosa = das Heim, das Zuhause)<br />
zuzuwenden. Das Ikhaya ist die – typischerweise dem ländlichen Raum der<br />
ehemaligen Transkei zugeschriebene – ›häuslich-soziale‹ Organisationsform.<br />
Die Zugehörigkeit zu dieser patrilinear strukturierten Gemeinschaft regelt<br />
die Verfügungsrechte über Land; sie bedeutet, entsprechend der kulturellen<br />
Norm sowie kollektiver Rollen- und Handlungserwartungen, Ansprüche gegenüber<br />
den anderen Mitgliedern geltend machen zu können, aber auch<br />
Verpflichtungen und Verantwortungen tragen zu müssen. Nicht die Koresidenz<br />
ist das entscheidende Kriterium für die Zugehörigkeit, vielmehr<br />
wird die Mitgliedschaft durch Geburt oder Heirat erworben. Das ländliche<br />
Gehöft (umzi pl. imizi) stellt zwar den gemeinsamen ›räumlichen Bezugspunkt‹<br />
der Ikhaya-Mitglieder dar, die Bewohner des Umzi sind aber selten<br />
identisch mit denen des Ikhaya. 27 Die Zusammensetzung der Bewohner-<br />
27 Vgl. Andrew Spiegel, The Fluidity of Household Composition in Matatiele, Transkei:<br />
A Methodological Problem, in: African Studies, 45. 1986, S. 17–35.<br />
180