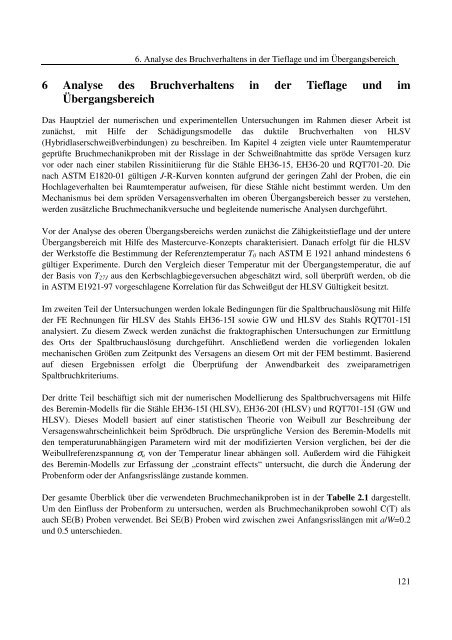Dokument 1.pdf (35.736 KB) - RWTH Aachen University
Dokument 1.pdf (35.736 KB) - RWTH Aachen University
Dokument 1.pdf (35.736 KB) - RWTH Aachen University
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
6. Analyse des Bruchverhaltens in der Tieflage und im Übergangsbereich<br />
6 Analyse des Bruchverhaltens in der Tieflage und im<br />
Übergangsbereich<br />
Das Hauptziel der numerischen und experimentellen Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit ist<br />
zunächst, mit Hilfe der Schädigungsmodelle das duktile Bruchverhalten von HLSV<br />
(Hybridlaserschweißverbindungen) zu beschreiben. Im Kapitel 4 zeigten viele unter Raumtemperatur<br />
geprüfte Bruchmechanikproben mit der Risslage in der Schweißnahtmitte das spröde Versagen kurz<br />
vor oder nach einer stabilen Rissinitiierung für die Stähle EH36-15, EH36-20 und RQT701-20. Die<br />
nach ASTM E1820-01 gültigen J-R-Kurven konnten aufgrund der geringen Zahl der Proben, die ein<br />
Hochlageverhalten bei Raumtemperatur aufweisen, für diese Stähle nicht bestimmt werden. Um den<br />
Mechanismus bei dem spröden Versagensverhalten im oberen Übergangsbereich besser zu verstehen,<br />
werden zusätzliche Bruchmechanikversuche und begleitende numerische Analysen durchgeführt.<br />
Vor der Analyse des oberen Übergangsbereichs werden zunächst die Zähigkeitstieflage und der untere<br />
Übergangsbereich mit Hilfe des Mastercurve-Konzepts charakterisiert. Danach erfolgt für die HLSV<br />
der Werkstoffe die Bestimmung der Referenztemperatur T0 nach ASTM E 1921 anhand mindestens 6<br />
gültiger Experimente. Durch den Vergleich dieser Temperatur mit der Übergangstemperatur, die auf<br />
der Basis von T27J aus den Kerbschlagbiegeversuchen abgeschätzt wird, soll überprüft werden, ob die<br />
in ASTM E1921-97 vorgeschlagene Korrelation für das Schweißgut der HLSV Gültigkeit besitzt.<br />
Im zweiten Teil der Untersuchungen werden lokale Bedingungen für die Spaltbruchauslösung mit Hilfe<br />
der FE Rechnungen für HLSV des Stahls EH36-15I sowie GW und HLSV des Stahls RQT701-15I<br />
analysiert. Zu diesem Zweck werden zunächst die fraktographischen Untersuchungen zur Ermittlung<br />
des Orts der Spaltbruchauslösung durchgeführt. Anschließend werden die vorliegenden lokalen<br />
mechanischen Größen zum Zeitpunkt des Versagens an diesem Ort mit der FEM bestimmt. Basierend<br />
auf diesen Ergebnissen erfolgt die Überprüfung der Anwendbarkeit des zweiparametrigen<br />
Spaltbruchkriteriums.<br />
Der dritte Teil beschäftigt sich mit der numerischen Modellierung des Spaltbruchversagens mit Hilfe<br />
des Beremin-Modells für die Stähle EH36-15I (HLSV), EH36-20I (HLSV) und RQT701-15I (GW und<br />
HLSV). Dieses Modell basiert auf einer statistischen Theorie von Weibull zur Beschreibung der<br />
Versagenswahrscheinlichkeit beim Sprödbruch. Die ursprüngliche Version des Beremin-Modells mit<br />
den temperaturunabhängigen Parametern wird mit der modifizierten Version verglichen, bei der die<br />
Weibullreferenzspannung σu von der Temperatur linear abhängen soll. Außerdem wird die Fähigkeit<br />
des Beremin-Modells zur Erfassung der „constraint effects“ untersucht, die durch die Änderung der<br />
Probenform oder der Anfangsrisslänge zustande kommen.<br />
Der gesamte Überblick über die verwendeten Bruchmechanikproben ist in der Tabelle 2.1 dargestellt.<br />
Um den Einfluss der Probenform zu untersuchen, werden als Bruchmechanikproben sowohl C(T) als<br />
auch SE(B) Proben verwendet. Bei SE(B) Proben wird zwischen zwei Anfangsrisslängen mit a/W=0.2<br />
und 0.5 unterschieden.<br />
121