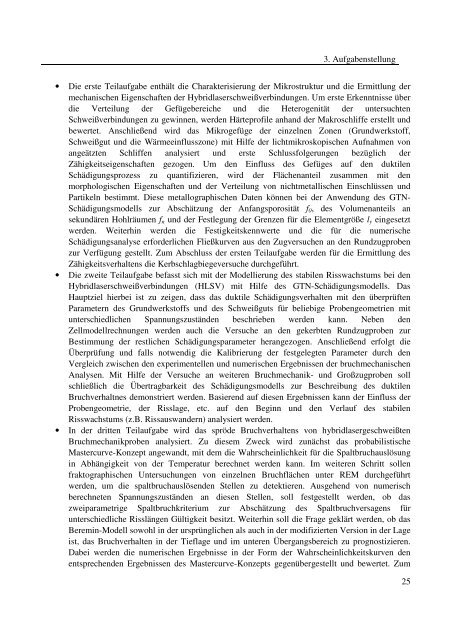Dokument 1.pdf (35.736 KB) - RWTH Aachen University
Dokument 1.pdf (35.736 KB) - RWTH Aachen University
Dokument 1.pdf (35.736 KB) - RWTH Aachen University
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
3. Aufgabenstellung<br />
• Die erste Teilaufgabe enthält die Charakterisierung der Mikrostruktur und die Ermittlung der<br />
mechanischen Eigenschaften der Hybridlaserschweißverbindungen. Um erste Erkenntnisse über<br />
die Verteilung der Gefügebereiche und die Heterogenität der untersuchten<br />
Schweißverbindungen zu gewinnen, werden Härteprofile anhand der Makroschliffe erstellt und<br />
bewertet. Anschließend wird das Mikrogefüge der einzelnen Zonen (Grundwerkstoff,<br />
Schweißgut und die Wärmeeinflusszone) mit Hilfe der lichtmikroskopischen Aufnahmen von<br />
angeätzten Schliffen analysiert und erste Schlussfolgerungen bezüglich der<br />
Zähigkeitseigenschaften gezogen. Um den Einfluss des Gefüges auf den duktilen<br />
Schädigungsprozess zu quantifizieren, wird der Flächenanteil zusammen mit den<br />
morphologischen Eigenschaften und der Verteilung von nichtmetallischen Einschlüssen und<br />
Partikeln bestimmt. Diese metallographischen Daten können bei der Anwendung des GTN-<br />
Schädigungsmodells zur Abschätzung der Anfangsporosität f0, des Volumenanteils an<br />
sekundären Hohlräumen fn und der Festlegung der Grenzen für die Elementgröße ly eingesetzt<br />
werden. Weiterhin werden die Festigkeitskennwerte und die für die numerische<br />
Schädigungsanalyse erforderlichen Fließkurven aus den Zugversuchen an den Rundzugproben<br />
zur Verfügung gestellt. Zum Abschluss der ersten Teilaufgabe werden für die Ermittlung des<br />
Zähigkeitsverhaltens die Kerbschlagbiegeversuche durchgeführt.<br />
• Die zweite Teilaufgabe befasst sich mit der Modellierung des stabilen Risswachstums bei den<br />
Hybridlaserschweißverbindungen (HLSV) mit Hilfe des GTN-Schädigungsmodells. Das<br />
Hauptziel hierbei ist zu zeigen, dass das duktile Schädigungsverhalten mit den überprüften<br />
Parametern des Grundwerkstoffs und des Schweißguts für beliebige Probengeometrien mit<br />
unterschiedlichen Spannungszuständen beschrieben werden kann. Neben den<br />
Zellmodellrechnungen werden auch die Versuche an den gekerbten Rundzugproben zur<br />
Bestimmung der restlichen Schädigungsparameter herangezogen. Anschließend erfolgt die<br />
Überprüfung und falls notwendig die Kalibrierung der festgelegten Parameter durch den<br />
Vergleich zwischen den experimentellen und numerischen Ergebnissen der bruchmechanischen<br />
Analysen. Mit Hilfe der Versuche an weiteren Bruchmechanik- und Großzugproben soll<br />
schließlich die Übertragbarkeit des Schädigungsmodells zur Beschreibung des duktilen<br />
Bruchverhaltnes demonstriert werden. Basierend auf diesen Ergebnissen kann der Einfluss der<br />
Probengeometrie, der Risslage, etc. auf den Beginn und den Verlauf des stabilen<br />
Risswachstums (z.B. Rissauswandern) analysiert werden.<br />
• In der dritten Teilaufgabe wird das spröde Bruchverhaltens von hybridlasergeschweißten<br />
Bruchmechanikproben analysiert. Zu diesem Zweck wird zunächst das probabilistische<br />
Mastercurve-Konzept angewandt, mit dem die Wahrscheinlichkeit für die Spaltbruchauslösung<br />
in Abhängigkeit von der Temperatur berechnet werden kann. Im weiteren Schritt sollen<br />
fraktographischen Untersuchungen von einzelnen Bruchflächen unter REM durchgeführt<br />
werden, um die spaltbruchauslösenden Stellen zu detektieren. Ausgehend von numerisch<br />
berechneten Spannungszuständen an diesen Stellen, soll festgestellt werden, ob das<br />
zweiparametrige Spaltbruchkriterium zur Abschätzung des Spaltbruchversagens für<br />
unterschiedliche Risslängen Gültigkeit besitzt. Weiterhin soll die Frage geklärt werden, ob das<br />
Beremin-Modell sowohl in der ursprünglichen als auch in der modifizierten Version in der Lage<br />
ist, das Bruchverhalten in der Tieflage und im unteren Übergangsbereich zu prognostizieren.<br />
Dabei werden die numerischen Ergebnisse in der Form der Wahrscheinlichkeitskurven den<br />
entsprechenden Ergebnissen des Mastercurve-Konzepts gegenübergestellt und bewertet. Zum<br />
25