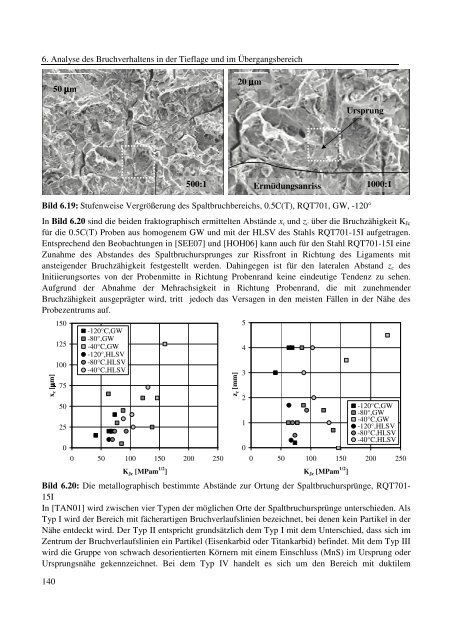Dokument 1.pdf (35.736 KB) - RWTH Aachen University
Dokument 1.pdf (35.736 KB) - RWTH Aachen University
Dokument 1.pdf (35.736 KB) - RWTH Aachen University
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
6. Analyse des Bruchverhaltens in der Tieflage und im Übergangsbereich<br />
Bild 6.19: Stufenweise Vergrößerung des Spaltbruchbereichs, 0.5C(T), RQT701, GW, -120°<br />
In Bild 6.20 sind die beiden fraktographisch ermittelten Abstände xc und zc über die Bruchzähigkeit KJc<br />
für die 0.5C(T) Proben aus homogenem GW und mit der HLSV des Stahls RQT701-15I aufgetragen.<br />
Entsprechend den Beobachtungen in [SEE07] und [HOH06] kann auch für den Stahl RQT701-15I eine<br />
Zunahme des Abstandes des Spaltbruchursprunges zur Rissfront in Richtung des Ligaments mit<br />
ansteigender Bruchzähigkeit festgestellt werden. Dahingegen ist für den lateralen Abstand zc des<br />
Initiierungsortes von der Probenmitte in Richtung Probenrand keine eindeutige Tendenz zu sehen.<br />
Aufgrund der Abnahme der Mehrachsigkeit in Richtung Probenrand, die mit zunehmender<br />
Bruchzähigkeit ausgeprägter wird, tritt jedoch das Versagen in den meisten Fällen in der Nähe des<br />
Probezentrums auf.<br />
x c [µm]<br />
140<br />
50 µm<br />
150<br />
125<br />
100<br />
75<br />
50<br />
25<br />
0<br />
-120°C,GW<br />
-80°,GW<br />
-40°C,GW<br />
-120°,HLSV<br />
-80°C,HLSV<br />
-40°C,HLSV<br />
0 50 100 150 200 250<br />
K Jc [MPam 1/2 ]<br />
500:1<br />
z c [mm]<br />
20 µm<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
Ermüdungsanriss<br />
0 50 100 150 200 250<br />
K Jc [MPam 1/2 ]<br />
Ursprung<br />
1000:1<br />
-120°C,GW<br />
-80°,GW<br />
-40°C,GW<br />
-120°,HLSV<br />
-80°C,HLSV<br />
-40°C,HLSV<br />
Bild 6.20: Die metallographisch bestimmte Abstände zur Ortung der Spaltbruchursprünge, RQT701-<br />
15I<br />
In [TAN01] wird zwischen vier Typen der möglichen Orte der Spaltbruchursprünge unterschieden. Als<br />
Typ I wird der Bereich mit fächerartigen Bruchverlaufslinien bezeichnet, bei denen kein Partikel in der<br />
Nähe entdeckt wird. Der Typ II entspricht grundsätzlich dem Typ I mit dem Unterschied, dass sich im<br />
Zentrum der Bruchverlaufslinien ein Partikel (Eisenkarbid oder Titankarbid) befindet. Mit dem Typ III<br />
wird die Gruppe von schwach desorientierten Körnern mit einem Einschluss (MnS) im Ursprung oder<br />
Ursprungsnähe gekennzeichnet. Bei dem Typ IV handelt es sich um den Bereich mit duktilem