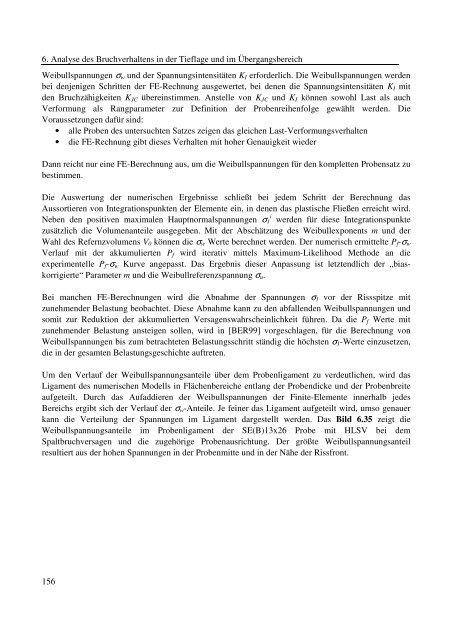Dokument 1.pdf (35.736 KB) - RWTH Aachen University
Dokument 1.pdf (35.736 KB) - RWTH Aachen University
Dokument 1.pdf (35.736 KB) - RWTH Aachen University
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
6. Analyse des Bruchverhaltens in der Tieflage und im Übergangsbereich<br />
Weibullspannungen σw und der Spannungsintensitäten KI erforderlich. Die Weibullspannungen werden<br />
bei denjenigen Schritten der FE-Rechnung ausgewertet, bei denen die Spannungsintensitäten KI mit<br />
den Bruchzähigkeiten KJC übereinstimmen. Anstelle von KJC und KI können sowohl Last als auch<br />
Verformung als Rangparameter zur Definition der Probenreihenfolge gewählt werden. Die<br />
Voraussetzungen dafür sind:<br />
• alle Proben des untersuchten Satzes zeigen das gleichen Last-Verformungsverhalten<br />
• die FE-Rechnung gibt dieses Verhalten mit hoher Genauigkeit wieder<br />
Dann reicht nur eine FE-Berechnung aus, um die Weibullspannungen für den kompletten Probensatz zu<br />
bestimmen.<br />
Die Auswertung der numerischen Ergebnisse schließt bei jedem Schritt der Berechnung das<br />
Aussortieren von Integrationspunkten der Elemente ein, in denen das plastische Fließen erreicht wird.<br />
Neben den positiven maximalen Hauptnormalspannungen σ1 i werden für diese Integrationspunkte<br />
zusätzlich die Volumenanteile ausgegeben. Mit der Abschätzung des Weibullexponents m und der<br />
Wahl des Refernzvolumens V0 können die σw Werte berechnet werden. Der numerisch ermittelte Pf-σw<br />
Verlauf mit der akkumulierten Pf wird iterativ mittels Maximum-Likelihood Methode an die<br />
experimentelle Pf-σw Kurve angepasst. Das Ergebnis dieser Anpassung ist letztendlich der „biaskorrigierte“<br />
Parameter m und die Weibullreferenzspannung σu.<br />
Bei manchen FE-Berechnungen wird die Abnahme der Spannungen σ1 vor der Rissspitze mit<br />
zunehmender Belastung beobachtet. Diese Abnahme kann zu den abfallenden Weibullspannungen und<br />
somit zur Reduktion der akkumulierten Versagenswahrscheinlichkeit führen. Da die Pf Werte mit<br />
zunehmender Belastung ansteigen sollen, wird in [BER99] vorgeschlagen, für die Berechnung von<br />
Weibullspannungen bis zum betrachteten Belastungsschritt ständig die höchsten σ1-Werte einzusetzen,<br />
die in der gesamten Belastungsgeschichte auftreten.<br />
Um den Verlauf der Weibullspannungsanteile über dem Probenligament zu verdeutlichen, wird das<br />
Ligament des numerischen Modells in Flächenbereiche entlang der Probendicke und der Probenbreite<br />
aufgeteilt. Durch das Aufaddieren der Weibullspannungen der Finite-Elemente innerhalb jedes<br />
Bereichs ergibt sich der Verlauf der σw-Anteile. Je feiner das Ligament aufgeteilt wird, umso genauer<br />
kann die Verteilung der Spannungen im Ligament dargestellt werden. Das Bild 6.35 zeigt die<br />
Weibullspannungsanteile im Probenligament der SE(B)13x26 Probe mit HLSV bei dem<br />
Spaltbruchversagen und die zugehörige Probenausrichtung. Der größte Weibullspannungsanteil<br />
resultiert aus der hohen Spannungen in der Probenmitte und in der Nähe der Rissfront.<br />
156