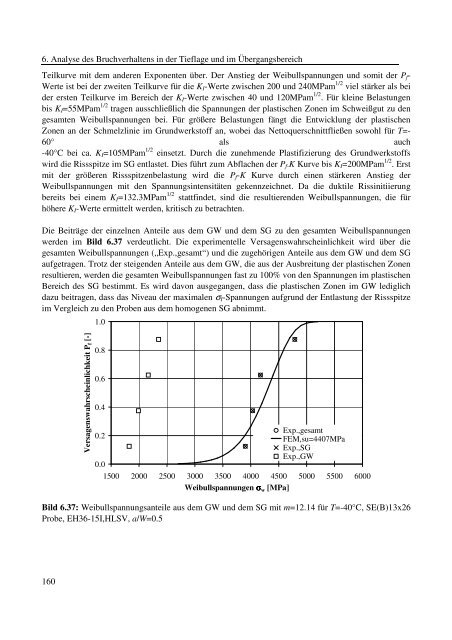Dokument 1.pdf (35.736 KB) - RWTH Aachen University
Dokument 1.pdf (35.736 KB) - RWTH Aachen University
Dokument 1.pdf (35.736 KB) - RWTH Aachen University
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
6. Analyse des Bruchverhaltens in der Tieflage und im Übergangsbereich<br />
Teilkurve mit dem anderen Exponenten über. Der Anstieg der Weibullspannungen und somit der Pf-<br />
Werte ist bei der zweiten Teilkurve für die KI-Werte zwischen 200 und 240MPam 1/2 viel stärker als bei<br />
der ersten Teilkurve im Bereich der KI-Werte zwischen 40 und 120MPam 1/2 . Für kleine Belastungen<br />
bis KI=55MPam 1/2 tragen ausschließlich die Spannungen der plastischen Zonen im Schweißgut zu den<br />
gesamten Weibullspannungen bei. Für größere Belastungen fängt die Entwicklung der plastischen<br />
Zonen an der Schmelzlinie im Grundwerkstoff an, wobei das Nettoquerschnittfließen sowohl für T=-<br />
60° als auch<br />
-40°C bei ca. KI=105MPam 1/2 einsetzt. Durch die zunehmende Plastifizierung des Grundwerkstoffs<br />
wird die Rissspitze im SG entlastet. Dies führt zum Abflachen der Pf-K Kurve bis KI=200MPam 1/2 . Erst<br />
mit der größeren Rissspitzenbelastung wird die Pf-K Kurve durch einen stärkeren Anstieg der<br />
Weibullspannungen mit den Spannungsintensitäten gekennzeichnet. Da die duktile Rissinitiierung<br />
bereits bei einem KI=132.3MPam 1/2 stattfindet, sind die resultierenden Weibullspannungen, die für<br />
höhere KI-Werte ermittelt werden, kritisch zu betrachten.<br />
Die Beiträge der einzelnen Anteile aus dem GW und dem SG zu den gesamten Weibullspannungen<br />
werden im Bild 6.37 verdeutlicht. Die experimentelle Versagenswahrscheinlichkeit wird über die<br />
gesamten Weibullspannungen („Exp.,gesamt“) und die zugehörigen Anteile aus dem GW und dem SG<br />
aufgetragen. Trotz der steigenden Anteile aus dem GW, die aus der Ausbreitung der plastischen Zonen<br />
resultieren, werden die gesamten Weibullspannungen fast zu 100% von den Spannungen im plastischen<br />
Bereich des SG bestimmt. Es wird davon ausgegangen, dass die plastischen Zonen im GW lediglich<br />
dazu beitragen, dass das Niveau der maximalen σI-Spannungen aufgrund der Entlastung der Rissspitze<br />
im Vergleich zu den Proben aus dem homogenen SG abnimmt.<br />
160<br />
Versagenswahrscheinlichkeit P f [-]<br />
1.0<br />
0.8<br />
0.6<br />
0.4<br />
0.2<br />
0.0<br />
Exp.,gesamt<br />
FEM,su=4407MPa<br />
Exp.,SG<br />
Exp.,GW<br />
1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000<br />
Weibullspannungen σ w [MPa]<br />
Bild 6.37: Weibullspannungsanteile aus dem GW und dem SG mit m=12.14 für T=-40°C, SE(B)13x26<br />
Probe, EH36-15I,HLSV, a/W=0.5