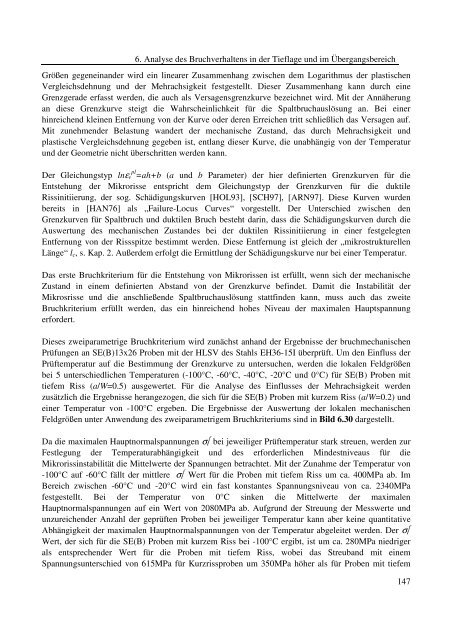Dokument 1.pdf (35.736 KB) - RWTH Aachen University
Dokument 1.pdf (35.736 KB) - RWTH Aachen University
Dokument 1.pdf (35.736 KB) - RWTH Aachen University
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
6. Analyse des Bruchverhaltens in der Tieflage und im Übergangsbereich<br />
Größen gegeneinander wird ein linearer Zusammenhang zwischen dem Logarithmus der plastischen<br />
Vergleichsdehnung und der Mehrachsigkeit festgestellt. Dieser Zusammenhang kann durch eine<br />
Grenzgerade erfasst werden, die auch als Versagensgrenzkurve bezeichnet wird. Mit der Annäherung<br />
an diese Grenzkurve steigt die Wahrscheinlichkeit für die Spaltbruchauslösung an. Bei einer<br />
hinreichend kleinen Entfernung von der Kurve oder deren Erreichen tritt schließlich das Versagen auf.<br />
Mit zunehmender Belastung wandert der mechanische Zustand, das durch Mehrachsigkeit und<br />
plastische Vergleichsdehnung gegeben ist, entlang dieser Kurve, die unabhängig von der Temperatur<br />
und der Geometrie nicht überschritten werden kann.<br />
Der Gleichungstyp lnεv pl =ah+b (a und b Parameter) der hier definierten Grenzkurven für die<br />
Entstehung der Mikrorisse entspricht dem Gleichungstyp der Grenzkurven für die duktile<br />
Rissinitiierung, der sog. Schädigungskurven [HOL93], [SCH97], [ARN97]. Diese Kurven wurden<br />
bereits in [HAN76] als „Failure-Locus Curves“ vorgestellt. Der Unterschied zwischen den<br />
Grenzkurven für Spaltbruch und duktilen Bruch besteht darin, dass die Schädigungskurven durch die<br />
Auswertung des mechanischen Zustandes bei der duktilen Rissinitiierung in einer festgelegten<br />
Entfernung von der Rissspitze bestimmt werden. Diese Entfernung ist gleich der „mikrostrukturellen<br />
Länge“ lc, s. Kap. 2. Außerdem erfolgt die Ermittlung der Schädigungskurve nur bei einer Temperatur.<br />
Das erste Bruchkriterium für die Entstehung von Mikrorissen ist erfüllt, wenn sich der mechanische<br />
Zustand in einem definierten Abstand von der Grenzkurve befindet. Damit die Instabilität der<br />
Mikrosrisse und die anschließende Spaltbruchauslösung stattfinden kann, muss auch das zweite<br />
Bruchkriterium erfüllt werden, das ein hinreichend hohes Niveau der maximalen Hauptspannung<br />
erfordert.<br />
Dieses zweiparametrige Bruchkriterium wird zunächst anhand der Ergebnisse der bruchmechanischen<br />
Prüfungen an SE(B)13x26 Proben mit der HLSV des Stahls EH36-15I überprüft. Um den Einfluss der<br />
Prüftemperatur auf die Bestimmung der Grenzkurve zu untersuchen, werden die lokalen Feldgrößen<br />
bei 5 unterschiedlichen Temperaturen (-100°C, -60°C, -40°C, -20°C und 0°C) für SE(B) Proben mit<br />
tiefem Riss (a/W=0.5) ausgewertet. Für die Analyse des Einflusses der Mehrachsigkeit werden<br />
zusätzlich die Ergebnisse herangezogen, die sich für die SE(B) Proben mit kurzem Riss (a/W=0.2) und<br />
einer Temperatur von -100°C ergeben. Die Ergebnisse der Auswertung der lokalen mechanischen<br />
Feldgrößen unter Anwendung des zweiparametrigem Bruchkriteriums sind in Bild 6.30 dargestellt.<br />
Da die maximalen Hauptnormalspannungen σI f bei jeweiliger Prüftemperatur stark streuen, werden zur<br />
Festlegung der Temperaturabhängigkeit und des erforderlichen Mindestniveaus für die<br />
Mikrorissinstabilität die Mittelwerte der Spannungen betrachtet. Mit der Zunahme der Temperatur von<br />
-100°C auf -60°C fällt der mittlere σI f Wert für die Proben mit tiefem Riss um ca. 400MPa ab. Im<br />
Bereich zwischen -60°C und -20°C wird ein fast konstantes Spannungsniveau von ca. 2340MPa<br />
festgestellt. Bei der Temperatur von 0°C sinken die Mittelwerte der maximalen<br />
Hauptnormalspannungen auf ein Wert von 2080MPa ab. Aufgrund der Streuung der Messwerte und<br />
unzureichender Anzahl der geprüften Proben bei jeweiliger Temperatur kann aber keine quantitative<br />
Abhängigkeit der maximalen Hauptnormalspannungen von der Temperatur abgeleitet werden. Der σI f<br />
Wert, der sich für die SE(B) Proben mit kurzem Riss bei -100°C ergibt, ist um ca. 280MPa niedriger<br />
als entsprechender Wert für die Proben mit tiefem Riss, wobei das Streuband mit einem<br />
Spannungsunterschied von 615MPa für Kurzrissproben um 350MPa höher als für Proben mit tiefem<br />
147