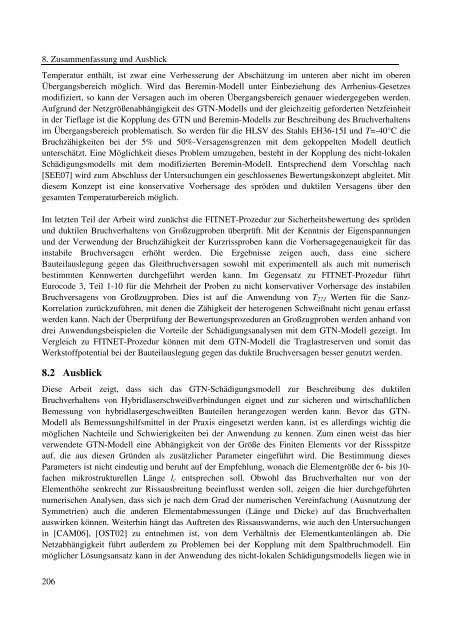Dokument 1.pdf (35.736 KB) - RWTH Aachen University
Dokument 1.pdf (35.736 KB) - RWTH Aachen University
Dokument 1.pdf (35.736 KB) - RWTH Aachen University
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
8. Zusammenfassung und Ausblick<br />
Temperatur enthält, ist zwar eine Verbesserung der Abschätzung im unteren aber nicht im oberen<br />
Übergangsbereich möglich. Wird das Beremin-Modell unter Einbeziehung des Arrhenius-Gesetzes<br />
modifiziert, so kann der Versagen auch im oberen Übergangsbereich genauer wiedergegeben werden.<br />
Aufgrund der Netzgrößenabhängigkeit des GTN-Modells und der gleichzeitig geforderten Netzfeinheit<br />
in der Tieflage ist die Kopplung des GTN und Beremin-Modells zur Beschreibung des Bruchverhaltens<br />
im Übergangsbereich problematisch. So werden für die HLSV des Stahls EH36-15I und T=-40°C die<br />
Bruchzähigkeiten bei der 5% und 50%-Versagensgrenzen mit dem gekoppelten Modell deutlich<br />
unterschätzt. Eine Möglichkeit dieses Problem umzugehen, besteht in der Kopplung des nicht-lokalen<br />
Schädigungsmodells mit dem modifizierten Beremin-Modell. Entsprechend dem Vorschlag nach<br />
[SEE07] wird zum Abschluss der Untersuchungen ein geschlossenes Bewertungskonzept abgleitet. Mit<br />
diesem Konzept ist eine konservative Vorhersage des spröden und duktilen Versagens über den<br />
gesamten Temperaturbereich möglich.<br />
Im letzten Teil der Arbeit wird zunächst die FITNET-Prozedur zur Sicherheitsbewertung des spröden<br />
und duktilen Bruchverhaltens von Großzugproben überprüft. Mit der Kenntnis der Eigenspannungen<br />
und der Verwendung der Bruchzähigkeit der Kurzrissproben kann die Vorhersagegenauigkeit für das<br />
instabile Bruchversagen erhöht werden. Die Ergebnisse zeigen auch, dass eine sichere<br />
Bauteilauslegung gegen das Gleitbruchversagen sowohl mit experimentell als auch mit numerisch<br />
bestimmten Kennwerten durchgeführt werden kann. Im Gegensatz zu FITNET-Prozedur führt<br />
Eurocode 3, Teil 1-10 für die Mehrheit der Proben zu nicht konservativer Vorhersage des instabilen<br />
Bruchversagens von Großzugproben. Dies ist auf die Anwendung von T27J Werten für die Sanz-<br />
Korrelation zurückzuführen, mit denen die Zähigkeit der heterogenen Schweißnaht nicht genau erfasst<br />
werden kann. Nach der Überprüfung der Bewertungsprozeduren an Großzugproben werden anhand von<br />
drei Anwendungsbeispielen die Vorteile der Schädigungsanalysen mit dem GTN-Modell gezeigt. Im<br />
Vergleich zu FITNET-Prozedur können mit dem GTN-Modell die Traglastreserven und somit das<br />
Werkstoffpotential bei der Bauteilauslegung gegen das duktile Bruchversagen besser genutzt werden.<br />
8.2 Ausblick<br />
Diese Arbeit zeigt, dass sich das GTN-Schädigungsmodell zur Beschreibung des duktilen<br />
Bruchverhaltens von Hybridlaserschweißverbindungen eignet und zur sicheren und wirtschaftlichen<br />
Bemessung von hybridlasergeschweißten Bauteilen herangezogen werden kann. Bevor das GTN-<br />
Modell als Bemessungshilfsmittel in der Praxis eingesetzt werden kann, ist es allerdings wichtig die<br />
möglichen Nachteile und Schwierigkeiten bei der Anwendung zu kennen. Zum einen weist das hier<br />
verwendete GTN-Modell eine Abhängigkeit von der Größe des Finiten Elements vor der Rissspitze<br />
auf, die aus diesen Gründen als zusätzlicher Parameter eingeführt wird. Die Bestimmung dieses<br />
Parameters ist nicht eindeutig und beruht auf der Empfehlung, wonach die Elementgröße der 6- bis 10fachen<br />
mikrostrukturellen Länge lc entsprechen soll. Obwohl das Bruchverhalten nur von der<br />
Elementhöhe senkrecht zur Rissausbreitung beeinflusst werden soll, zeigen die hier durchgeführten<br />
numerischen Analysen, dass sich je nach dem Grad der numerischen Vereinfachung (Ausnutzung der<br />
Symmetrien) auch die anderen Elementabmessungen (Länge und Dicke) auf das Bruchverhalten<br />
auswirken können. Weiterhin hängt das Auftreten des Rissauswanderns, wie auch den Untersuchungen<br />
in [CAM06], [OST02] zu entnehmen ist, von dem Verhältnis der Elementkantenlängen ab. Die<br />
Netzabhängigkeit führt außerdem zu Problemen bei der Kopplung mit dem Spaltbruchmodell. Ein<br />
möglicher Lösungsansatz kann in der Anwendung des nicht-lokalen Schädigungsmodells liegen wie in<br />
206