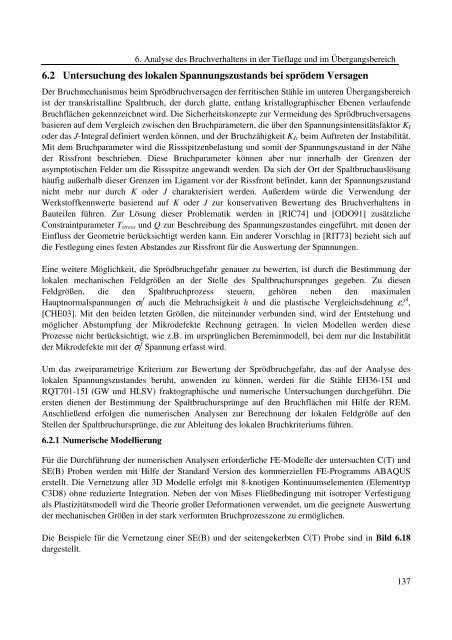Dokument 1.pdf (35.736 KB) - RWTH Aachen University
Dokument 1.pdf (35.736 KB) - RWTH Aachen University
Dokument 1.pdf (35.736 KB) - RWTH Aachen University
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
6. Analyse des Bruchverhaltens in der Tieflage und im Übergangsbereich<br />
6.2 Untersuchung des lokalen Spannungszustands bei sprödem Versagen<br />
Der Bruchmechanismus beim Sprödbruchversagen der ferritischen Stähle im unteren Übergangsbereich<br />
ist der transkristalline Spaltbruch, der durch glatte, entlang kristallographischer Ebenen verlaufende<br />
Bruchflächen gekennzeichnet wird. Die Sicherheitskonzepte zur Vermeidung des Sprödbruchversagens<br />
basieren auf dem Vergleich zwischen den Bruchparametern, die über den Spannungsintensitätsfaktor KI<br />
oder das J-Integral definiert werden können, und der Bruchzähigkeit KJc beim Auftreten der Instabilität.<br />
Mit dem Bruchparameter wird die Rissspitzenbelastung und somit der Spannungszustand in der Nähe<br />
der Rissfront beschrieben. Diese Bruchparameter können aber nur innerhalb der Grenzen der<br />
asymptotischen Felder um die Rissspitze angewandt werden. Da sich der Ort der Spaltbruchauslösung<br />
häufig außerhalb dieser Grenzen im Ligament vor der Rissfront befindet, kann der Spannungszustand<br />
nicht mehr nur durch K oder J charakterisiert werden. Außerdem würde die Verwendung der<br />
Werkstoffkennwerte basierend auf K oder J zur konservativen Bewertung des Bruchverhaltens in<br />
Bauteilen führen. Zur Lösung dieser Problematik werden in [RIC74] und [ODO91] zusätzliche<br />
Constraintparameter Tstress und Q zur Beschreibung des Spannungszustandes eingeführt, mit denen der<br />
Einfluss der Geometrie berücksichtigt werden kann. Ein anderer Vorschlag in [RIT73] bezieht sich auf<br />
die Festlegung eines festen Abstandes zur Rissfront für die Auswertung der Spannungen.<br />
Eine weitere Möglichkeit, die Sprödbruchgefahr genauer zu bewerten, ist durch die Bestimmung der<br />
lokalen mechanischen Feldgrößen an der Stelle des Spaltbruchursprunges gegeben. Zu diesen<br />
Feldgrößen, die den Spaltbruchprozess steuern, gehören neben den maximalen<br />
Hauptnormalspannungen σI f auch die Mehrachsigkeit h und die plastische Vergleichsdehnung εv pl ,<br />
[CHE03]. Mit den beiden letzten Größen, die miteinander verbunden sind, wird der Entstehung und<br />
möglicher Abstumpfung der Mikrodefekte Rechnung getragen. In vielen Modellen werden diese<br />
Prozesse nicht berücksichtigt, wie z.B. im ursprünglichen Bereminmodell, bei dem nur die Instabilität<br />
der Mikrodefekte mit der σI f Spannung erfasst wird.<br />
Um das zweiparametrige Kriterium zur Bewertung der Sprödbruchgefahr, das auf der Analyse des<br />
lokalen Spannungszustandes beruht, anwenden zu können, werden für die Stähle EH36-15I und<br />
RQT701-15I (GW und HLSV) fraktographische und numerische Untersuchungen durchgeführt. Die<br />
ersten dienen der Bestimmung der Spaltbruchursprünge auf den Bruchflächen mit Hilfe der REM.<br />
Anschließend erfolgen die numerischen Analysen zur Berechnung der lokalen Feldgröße auf den<br />
Stellen der Spaltbruchursprünge, die zur Ableitung des lokalen Bruchkriteriums führen.<br />
6.2.1 Numerische Modellierung<br />
Für die Durchführung der numerischen Analysen erforderliche FE-Modelle der untersuchten C(T) und<br />
SE(B) Proben werden mit Hilfe der Standard Version des kommerziellen FE-Programms ABAQUS<br />
erstellt. Die Vernetzung aller 3D Modelle erfolgt mit 8-knotigen Kontinuumselementen (Elementtyp<br />
C3D8) ohne reduzierte Integration. Neben der von Mises Fließbedingung mit isotroper Verfestigung<br />
als Plastizitätsmodell wird die Theorie großer Deformationen verwendet, um die geeignete Auswertung<br />
der mechanischen Größen in der stark verformten Bruchprozesszone zu ermöglichen.<br />
Die Beispiele für die Vernetzung einer SE(B) und der seitengekerbten C(T) Probe sind in Bild 6.18<br />
dargestellt.<br />
137