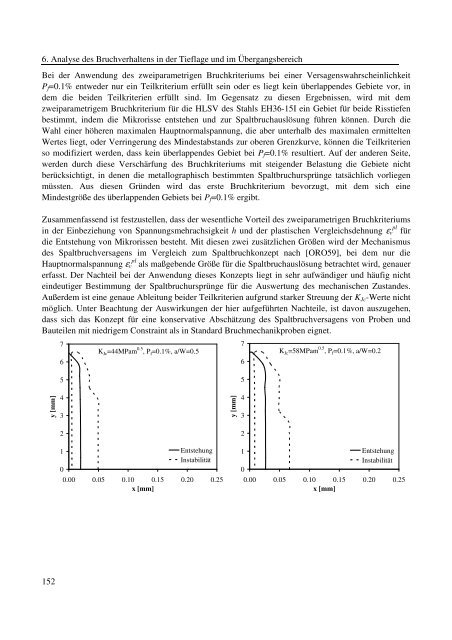Dokument 1.pdf (35.736 KB) - RWTH Aachen University
Dokument 1.pdf (35.736 KB) - RWTH Aachen University
Dokument 1.pdf (35.736 KB) - RWTH Aachen University
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
6. Analyse des Bruchverhaltens in der Tieflage und im Übergangsbereich<br />
Bei der Anwendung des zweiparametrigen Bruchkriteriums bei einer Versagenswahrscheinlichkeit<br />
Pf=0.1% entweder nur ein Teilkriterium erfüllt sein oder es liegt kein überlappendes Gebiete vor, in<br />
dem die beiden Teilkriterien erfüllt sind. Im Gegensatz zu diesen Ergebnissen, wird mit dem<br />
zweiparametrigem Bruchkriterium für die HLSV des Stahls EH36-15I ein Gebiet für beide Risstiefen<br />
bestimmt, indem die Mikrorisse entstehen und zur Spaltbruchauslösung führen können. Durch die<br />
Wahl einer höheren maximalen Hauptnormalspannung, die aber unterhalb des maximalen ermittelten<br />
Wertes liegt, oder Verringerung des Mindestabstands zur oberen Grenzkurve, können die Teilkriterien<br />
so modifiziert werden, dass kein überlappendes Gebiet bei Pf=0.1% resultiert. Auf der anderen Seite,<br />
werden durch diese Verschärfung des Bruchkriteriums mit steigender Belastung die Gebiete nicht<br />
berücksichtigt, in denen die metallographisch bestimmten Spaltbruchursprünge tatsächlich vorliegen<br />
müssten. Aus diesen Gründen wird das erste Bruchkriterium bevorzugt, mit dem sich eine<br />
Mindestgröße des überlappenden Gebiets bei Pf=0.1% ergibt.<br />
Zusammenfassend ist festzustellen, dass der wesentliche Vorteil des zweiparametrigen Bruchkriteriums<br />
in der Einbeziehung von Spannungsmehrachsigkeit h und der plastischen Vergleichsdehnung εv pl für<br />
die Entstehung von Mikrorissen besteht. Mit diesen zwei zusätzlichen Größen wird der Mechanismus<br />
des Spaltbruchversagens im Vergleich zum Spaltbruchkonzept nach [ORO59], bei dem nur die<br />
Hauptnormalspannung εv pl als maßgebende Größe für die Spaltbruchauslösung betrachtet wird, genauer<br />
erfasst. Der Nachteil bei der Anwendung dieses Konzepts liegt in sehr aufwändiger und häufig nicht<br />
eindeutiger Bestimmung der Spaltbruchursprünge für die Auswertung des mechanischen Zustandes.<br />
Außerdem ist eine genaue Ableitung beider Teilkriterien aufgrund starker Streuung der KJc-Werte nicht<br />
möglich. Unter Beachtung der Auswirkungen der hier aufgeführten Nachteile, ist davon auszugehen,<br />
dass sich das Konzept für eine konservative Abschätzung des Spaltbruchversagens von Proben und<br />
Bauteilen mit niedrigem Constraint als in Standard Bruchmechanikproben eignet.<br />
y [mm]<br />
152<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
K Jc=44MPam 0.5 , P f=0.1%, a/W=0.5<br />
Entstehung<br />
Instabilität<br />
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25<br />
x [mm]<br />
y [mm]<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
K Jc=58MPam 0.5 , P f=0.1%, a/W=0.2<br />
1<br />
0<br />
Entstehung<br />
Instabilität<br />
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25<br />
x [mm]