5/43-2 - Landtag Brandenburg - Land Brandenburg
5/43-2 - Landtag Brandenburg - Land Brandenburg
5/43-2 - Landtag Brandenburg - Land Brandenburg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Prof. Dr. Martini - Stellungnahme ‚Zeitliche Obergrenze für einen Vorteilsausgleich bei Anschlussbeiträgen"<br />
lang keiner ausdrücklichen Höchstfrist unterworfen sind. Das betrifft insbesondere den Rückforderungsanspruch"<br />
nach § 1 Abs. 1 BbgVwVfG I. V. m. § 49a Abs. 1 BVwVfG. Wie im Falle des brandenburgischen KAG<br />
hängt die Geltendmachung des Anspruchs hier von einem Akt der Behörde, nämlich der Festsetzung einer Zahlungsverpflichtung<br />
auf der Grundlage einer rückwirkenden Aufhebung eines vorangegangenen begünstigenden<br />
Verwaltungsaktes, ab. Zwischen der Gewährung des staatlichen Vorteils und der Forderung nach einem Ausgleich<br />
kann ein sehr langer Zeitraum liegen, der das Bedürfnis nach Rechtssicherheit auslöst. 45<br />
Das BVerwG hat sich in seiner Rechtsprechung mit diesen Konstellationen in der Vergangenheit bereits auseinandergesetzt.<br />
Es sieht den Rückforderungsanspruch" einer 30-jährigen Verjährungsfrist unterworfen. Das<br />
Gesetz formuliert diese nicht ausdrücklich. Das BVerwG entnimmt diese Frist einem allgemeinen (auch nach<br />
Inkrafttreten der Schuldrechtsreform fortgeltenden) Rechtsgedanken. 47 Dieser allgemeine Rechtsgedanke, den<br />
das BVerwG für das öffentliche Recht entwickelt hat, beansprucht grundsätzlich auch für die Verjährung abgabenrechtlicher<br />
Ansprüche Geltung. Das BVerfG verlangt dem Gesetzgeber aber eine klare normative Entscheidung<br />
ab. Soweit im Rahmen des §§ 49a Abs. 2 VwVfG Rechtssicherheit nicht durch andere Faktoren sichergestellt<br />
ist, ist er womöglich ebenso dem Verdikt der Verfassungswidrigkeit unterworfen. Denn der Gesetzgeber<br />
selbst ist danach aufgerufen, eine klare, hinreichend konkrete Frist zu setzen: »Der Grundsatz der Rechtssicherheit<br />
verbietet es dem Gesetzgeber, (...) ganz von einer Regelung abzusehen, die der Erhebung der Abgabe<br />
eine bestimmte zeitliche Grenze setzt.« 48<br />
6. Wie können diese Änderungen ausgestaltet werden?<br />
7. Welche rechtlichen und tatsächlichen Folgen ziehen die in Betracht kommenden<br />
Änderungsmöglichkeiten nach sich?<br />
Für die beiden virulenten Problemfälle (vgl. oben 3.) muss der Gesetzgeber sicherstellen,<br />
dass die Beiträge nicht unbegrenzt nach Erlangung des Vorteils festgesetzt werden können.<br />
Der Empfänger des Vorteils muss »in zumutbarer Zeit darüber Klarheit gewinnen können, ob<br />
und in welchem Umfang er die erlangten Vorteile durch Beiträge ausgleichen muss«. 49 Dem<br />
44 Für die Befugnis zur Rücknahme selbst sehen die meisten Autoren in den gesetzlichen Rücknahmeregelungen des § 48<br />
Abs. 2 und 4 VwVfG ein differenziertes und abgewogenes Vertrauensschutzkonzept, das den Faktor Zeitablauf in hinreichend<br />
rechtssicherer Weise rechtlich umsetzt. Vgl. BeckRS 2009, 41534; Erfmeyer, VR 1999, 48 (51 f.). Für den Bereich des<br />
Sozialrechts ist das BSG demgegenüber zu dem Ergebnis gelangt, dass ein rechtswidriger Sozialleistungsbescheid mit Dauerwirkung<br />
30 Jahre nach seinem Erlass selbst dann nicht mehr mit Rückwirkung zurückgenommen kann, wenn er durch arglistige<br />
Täuschung erwirkt worden ist (BSGE 72, 139 [145<br />
45 Für das Sozialrecht enthält § 50 Abs. 4 SGB X zwar eine Verjährungsfrist von 4 Jahren. Sie beginnt nach Ablauf des Kalenderjahres,<br />
in dem der Rückforderungsbescheid unanfechtbar geworden ist, Auch sie schließt es aber nicht aus, dass zwischen<br />
der Gewährung und der Rückforderung des Vorteils eine zeitlich nicht bestimmbare, für den Bürger unsichere Zeitspanne<br />
verstreichen kann. Um dem Gedanken der Rechtssicherheit Rechnung zu tragen, müsste der Gesetzgeber das Rücknahmerecht<br />
der Verwaltung selbst einer Verjährung unterwerfen. Anderenfalls hätte die Verwaltung die Möglichkeit und<br />
einen Anreiz, die Verjährung dadurch beliebig nach hinten zu schieben, dass sie nach der Rücknahme den Festsetzungsbescheid<br />
für die Rückforderung zeitlich aufschiebt. In diesem Sinne kritisch auch Guckelberger, Die Verjährung im Öffentlichen<br />
Recht, 5. 375 f.<br />
48 Für den Zinsanspruch nach § 49 Abs. 2 VwVfG gilt etwas anderes. Die Verwaltungsgerichte wenden auf diesen Fall die<br />
Dreijahresfrist des § 195 BGB n.F. analog an. BVerwG, NVwZ 2011, 949 (954, Rn. 50); OVG Sachsen, NVwZ-RR 2013, 82; HessVGH,<br />
BeckRS 2012, 46951; OVG Thüringen, BeckRS 2011, 53681,<br />
47 BVerwG, NVwZ 2011, 949 ff.<br />
48 BVerfG, Beschluss vom 5.3.2013, Rn. 46. Daraus ergeben sich zwei mögliche Interpretationswege: Entweder ist mithin<br />
dem BVerfG der allgemeine Rechtsgedanke als dem Rechtsstaatsprinzip genügender Fristrahmen nicht hinreichend präzise<br />
und ausreichend, um Rechtssicherheit herzustellen (dann ist konsequenterweise auch § 49a VwVfG dem Verdikt der Verfassungswidrigkeit<br />
ausgesetzt) oder es hält für den konkreten Fall des Abgabenrechts eine 30-jährige Verjährungsfrist für verfassungsrechtlich<br />
unzureichend.<br />
49 BVerfG, Beschl. v. 5.3.2013, Rn. 50.<br />
12



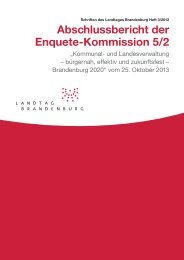

![Rede vom 26.02.2013 [ PDF , 259.1 KB] - Landtag Brandenburg](https://img.yumpu.com/24785568/1/184x260/rede-vom-26022013-pdf-2591-kb-landtag-brandenburg.jpg?quality=85)

![Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft am 11.09.2013 [ PDF , 5.2 MB]](https://img.yumpu.com/24785559/1/184x260/sitzung-des-ausschusses-fur-wirtschaft-am-11092013-pdf-52-mb.jpg?quality=85)








