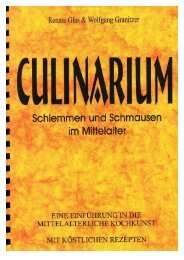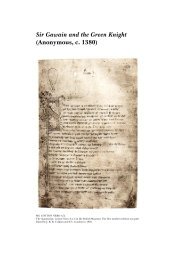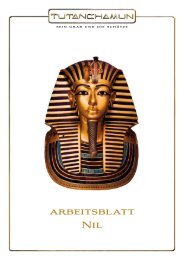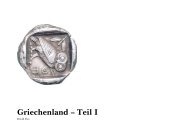Mommsen, Theodor, Römische Geschichte, Zweites ... - nubuk.com
Mommsen, Theodor, Römische Geschichte, Zweites ... - nubuk.com
Mommsen, Theodor, Römische Geschichte, Zweites ... - nubuk.com
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
177<br />
gewaltigen Machtentwicklung Roms – wohl erkannte Pyrrhos’ scharfer Soldatenblick<br />
die Ursache des politischen und militärischen Übergewichts der Römer in<br />
dem blühenden Zustande der römischen Bauernwirtschaften. Aber auch das Aufkommen<br />
der Großwirtschaft in dem römischen Ackerbau scheint in diese Zeit zu<br />
fallen. In der älteren Zeit gab es wohl auch schon einen – wenigstens verhältnismäßig<br />
– großen Grundbesitz; aber dessen Bewirtschaftung war keine Groß-, sondern<br />
nur eine vervielfältigte Kleinwirtschaft (I, 204). Dagegen darf die mit der älteren<br />
Wirtschaftsweise zwar nicht unvereinbare, aber doch der späteren bei weitem<br />
angemessenere Bestimmung des Gesetzes vom Jahre 387 (367), daß der Grundbesitzer<br />
neben den Sklaven eine verhältnismäßige Zahl freier Leute zu verwenden<br />
verbunden sei, wohl als die älteste Spur der späteren zentralisierten Gutswirtschaft<br />
angesehen werden 6 ; und es ist bemerkenswert, daß gleich hier bei ihrem ersten<br />
Vorkommen dieselbe wesentlich auf dem Sklavenhalten ruht. Wie sie aufkam, muß<br />
dahingestellt bleiben; möglich ist es, daß die karthagischen Pflanzungen auf Sizilien<br />
schon den ältesten römischen Gutsbesitzern als Muster gedient haben und vielleicht<br />
steht selbst das Aufkommen des Weizens in der Landwirtschaft neben dem<br />
Spelt, das Varro um die Zeit der Dezemvirn setzt, mit dieser veränderten Wirtschaftsweise<br />
in Zusammenhang. Noch weniger läßt sich ermitteln, wie weit diese<br />
Wirtschaftsweise schon in dieser Epoche um sich gegriffen hat; nur daran, daß sie<br />
noch nicht Regel gewesen sein und den italischen Bauernstand noch nicht absorbiert<br />
haben kann, läßt die <strong>Geschichte</strong> des Hannibalischen Krieges keinen Zweifel.<br />
Wo sie aber aufkam, vernichtete sie die ältere, auf dem Bittbesitz beruhende Klientel;<br />
ähnlich wie die heutige Gutswirtschaft großenteils durch Niederlegung der<br />
Bauernstellen und Verwandlung der Hufen in Hoffeld entstanden ist. Es ist keinem<br />
Zweifel unterworfen, daß zu der Bedrängnis des kleinen Ackerbauernstandes eben<br />
das Einschränken dieser Ackerklientel höchst wesentlich mitgewirkt hat.<br />
Über den inneren Verkehr der Italiker untereinander sind die schriftlichen Quellen<br />
stumm; einigen Aufschluß geben lediglich die Münzen. Daß in Italien, von den<br />
griechischen Städten und dem etruskischen Populonia abgesehen, während der ersten<br />
drei Jahrhunderte Roms nicht gemünzt ward und als Tauschmaterial anfangs<br />
das Vieh, später Kupfer nach dem Gewicht diente, wurde schon gesagt. In die gegenwärtige<br />
Epoche fällt der Übergang der Italiker vom Tausch- zum Geldsystem,<br />
wobei man natürlich zunächst auf griechische Muster sich hingewiesen sah. Es<br />
lag indes in den Verhältnissen, daß in Mittelitalien statt des Silbers das Kupfer<br />
zum Münzmetall ward und die Münzeinheit sich zunächst anlehnte an die bisherige<br />
Werteinheit, das Kupferpfund; womit es zusammenhängt, daß man die Münzen<br />
6 Auch Varro (rust. 1, 2, 9) denkt sich den Urheber des Licinischen Ackergesetzes offenbar als<br />
Selbstbewirtschafter seiner ausgedehnten Ländereien; obgleich übrigens die Anekdote leicht erfunden<br />
sein kann, um den Beinamen zu erklären.