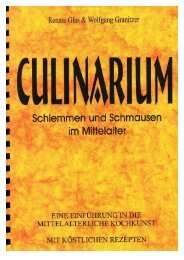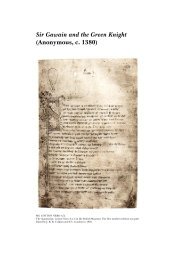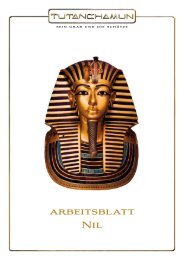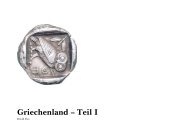Mommsen, Theodor, Römische Geschichte, Zweites ... - nubuk.com
Mommsen, Theodor, Römische Geschichte, Zweites ... - nubuk.com
Mommsen, Theodor, Römische Geschichte, Zweites ... - nubuk.com
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
178 KAPITEL 8. RECHT, RELIGION, KRIEGSWESEN, . . .<br />
goß, statt sie zu prägen, denn kein Stempel hätte ausgereicht für so große und<br />
schwere Stücke. Doch scheint von Haus aus zwischen Kupfer und Silber ein festes<br />
Gleichungsverhältnis (250 : 1) normiert und die Kupfermünze mit Rücksicht<br />
darauf ausgebracht worden zu sein, so daß zum Beispiel in Rom das große Kupferstück,<br />
der As, dem Werte nach einem Skrupel (= 1/288 Pfund) Silber gleichkam.<br />
Geschichtlich bemerkenswerter ist es, daß die Münze in Italien höchst wahrscheinlich<br />
von Rom ausgegangen ist und zwar eben von den Dezemvirn, die in der Solonischen<br />
Gesetzgebung das Vorbild auch zur Regulierung des Münzwesens fanden,<br />
und daß sie von Rom aus sich verbreitete über eine Anzahl latinischer, etruskischer,<br />
umbrischer und ostitalischer Gemeinden; zum deutlichen Beweise der überlegenen<br />
Stellung, die Rom schon seit dem Anfang des vierten Jahrhunderts in Italien behauptete.<br />
Wie alle diese Gemeinden formell unabhängig nebeneinander standen,<br />
war gesetzlich auch der Münzfuß durchaus örtlich und jedes Stadtgebiet ein eigenes<br />
Münzgebiet; indes lassen sich doch die mittel- und norditalischen Kupfermünzfüße<br />
in drei Gruppen zusammenfassen, innerhalb welcher man die Münzen<br />
im gemeinen Verkehr als gleichartig behandelt zu haben scheint. Es sind dies teils<br />
die Münzen der nördlich vom Ciminischen Walde gelegenen etruskischen und der<br />
umbrischen Städte, teils die Münzen von Rom und Latium, teils die des östlichen<br />
Litorals. Daß die römischen Münzen mit dem Silber nach dem Gewicht geglichen<br />
waren, ist schon bemerkt worden: diejenigen der italischen Ostküste finden wir dagegen<br />
in ein bestimmtes Verhältnis gesetzt zu den Silbermünzen, die im südlichen<br />
Italien seit alter Zeit gangbar waren und deren Fuß sich auch die italischen Einwanderer,<br />
zum Beispiel die Brettier, Lucaner, Nolaner, ja die latinischen Kolonien<br />
daselbst wie Cales und Suessa und sogar die Römer selbst für ihre unteritalischen<br />
Besitzungen aneigneten. Danach wird auch der italische Binnenhandel in dieselben<br />
Gebiete zerfallen sein, welche unter sich verkehrten gleich fremden Völkern.<br />
Im überseeischen Verkehr bestanden die früher bezeichneten sizilisch-latinischen,<br />
etruskisch-attischen und adriatisch-tarentinischen Handelsbeziehungen auch in dieser<br />
Epoche fort oder gehören ihr vielmehr recht eigentlich an; denn obwohl die<br />
derartigen, in der Regel ohne Zeitangabe vorkommenden Tatsachen der Obersicht<br />
wegen schon bei der ersten Periode zusammengefaßt worden sind, erstrecken sich<br />
diese Angaben doch ebensowohl auf die gegenwärtige mit. Am deutlichsten sprechen<br />
auch hierfür die Münzen. Wie die Prägung des etruskischen Silbergeldes auf<br />
attischen Fuß und das Eindringen des italischen und besonders latinischen Kupfers<br />
in Sizilien für die ersten beiden Handelszüge zeugen, so spricht die eben erwähnte<br />
Gleichstellung des großgriechischen Silbergeldes mit der picenischen und apulischen<br />
Kupfermünze nebst zahlreichen anderen Spuren für den regen Verkehr der<br />
unteritalischen Griechen, namentlich der Tarentiner mit dem ostitalischen Litoral.<br />
Dagegen scheint der früher wohl lebhaftere Handel zwischen den Latinern und<br />
den kampanischen Griechen durch die sabellische Einwanderung gestört worden