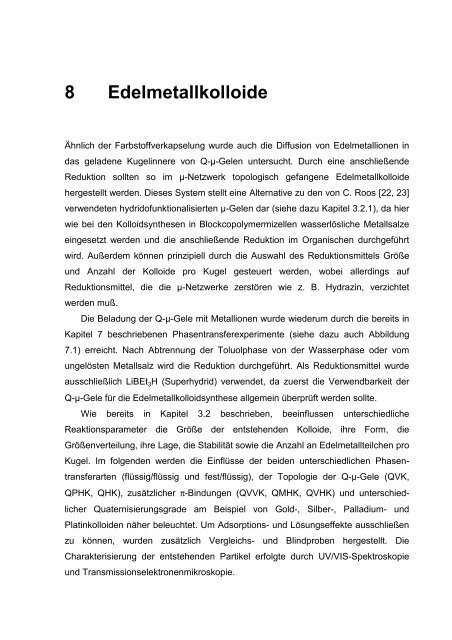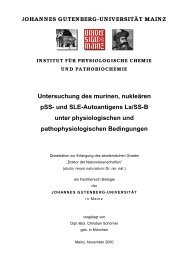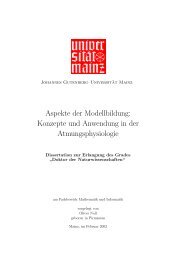R - ArchiMeD
R - ArchiMeD
R - ArchiMeD
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
8 Edelmetallkolloide<br />
Ähnlich der Farbstoffverkapselung wurde auch die Diffusion von Edelmetallionen in<br />
das geladene Kugelinnere von Q-µ-Gelen untersucht. Durch eine anschließende<br />
Reduktion sollten so im µ-Netzwerk topologisch gefangene Edelmetallkolloide<br />
hergestellt werden. Dieses System stellt eine Alternative zu den von C. Roos [22, 23]<br />
verwendeten hydridofunktionalisierten µ-Gelen dar (siehe dazu Kapitel 3.2.1), da hier<br />
wie bei den Kolloidsynthesen in Blockcopolymermizellen wasserlösliche Metallsalze<br />
eingesetzt werden und die anschließende Reduktion im Organischen durchgeführt<br />
wird. Außerdem können prinzipiell durch die Auswahl des Reduktionsmittels Größe<br />
und Anzahl der Kolloide pro Kugel gesteuert werden, wobei allerdings auf<br />
Reduktionsmittel, die die µ-Netzwerke zerstören wie z. B. Hydrazin, verzichtet<br />
werden muß.<br />
Die Beladung der Q-µ-Gele mit Metallionen wurde wiederum durch die bereits in<br />
Kapitel 7 beschriebenen Phasentransferexperimente (siehe dazu auch Abbildung<br />
7.1) erreicht. Nach Abtrennung der Toluolphase von der Wasserphase oder vom<br />
ungelösten Metallsalz wird die Reduktion durchgeführt. Als Reduktionsmittel wurde<br />
ausschließlich LiBEt3H (Superhydrid) verwendet, da zuerst die Verwendbarkeit der<br />
Q-µ-Gele für die Edelmetallkolloidsynthese allgemein überprüft werden sollte.<br />
Wie bereits in Kapitel 3.2 beschrieben, beeinflussen unterschiedliche<br />
Reaktionsparameter die Größe der entstehenden Kolloide, ihre Form, die<br />
Größenverteilung, ihre Lage, die Stabilität sowie die Anzahl an Edelmetallteilchen pro<br />
Kugel. Im folgenden werden die Einflüsse der beiden unterschiedlichen Phasentransferarten<br />
(flüssig/flüssig und fest/flüssig), der Topologie der Q-µ-Gele (QVK,<br />
QPHK, QHK), zusätzlicher π-Bindungen (QVVK, QMHK, QVHK) und unterschied-<br />
licher Quaternisierungsgrade am Beispiel von Gold-, Silber-, Palladium- und<br />
Platinkolloiden näher beleuchtet. Um Adsorptions- und Lösungseffekte ausschließen<br />
zu können, wurden zusätzlich Vergleichs- und Blindproben hergestellt. Die<br />
Charakterisierung der entstehenden Partikel erfolgte durch UV/VIS-Spektroskopie<br />
und Transmissionselektronenmikroskopie.