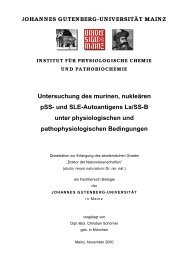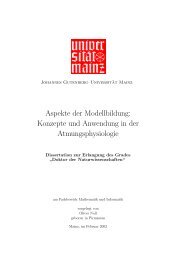R - ArchiMeD
R - ArchiMeD
R - ArchiMeD
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
8 Edelmetallkolloide 151<br />
Neben wenigen großen Kolloiden sind auf allen Aufnahmen sehr viele<br />
silberkolloidgefüllte µ-Netzwerke zu sehen. Bei QPHK12 ist die Größenverteilung der<br />
Cluster breiter als bei QVK12 und QVHK12. Es befindet sich pro Kugel ein Kolloid im<br />
Inneren. Es können wie bei Gold ebenfalls keine Unterschiede bezüglich der Lage<br />
der Kolloide zwischen µ-Gelen mit und ohne π-Bindungen festgestellt werde.<br />
Vielmehr ist das topologische Gefangensein der Kolloide vermutlich auf ein sehr<br />
schnelles Wachstum der entstehenden Keime und eine ausreichende Menge<br />
Silberionen in den µ-Gelen zurückzuführen. Die ist insbesondere erstaunlich, da die<br />
Silberionen als freie positive Ionen und nicht als negativer Komplex eingesetzt<br />
werden.<br />
Abbildung 8.11 zeigt eine TEM-Aufnahme des fest/flüssig Experiments mit<br />
QVK12. Die Aufnahme bestätigt die UV/VIS-Messung; die Größenverteilung ist sehr<br />
breit, obwohl sich der riesige Cluster sicherlich erst nach der Messung des<br />
Absorptionsspektrums gebildet hat. Im Unterschied zu den Goldkolloiden können bei<br />
Silber auch mit dem fest/flüssig Phasentransfer einige gefüllte Kugeln erhalten<br />
werden, da das Keimwachstum vermutlich sehr schnell verläuft.<br />
50 nm<br />
Abb. 8.11: TEM-Aufnahme der silberkolloidhaltigen Q-µ-Gelprobe QVK12,<br />
hergestellt durch fest/flüssig Phasentransfer, Probenpräparation: aus toluolischer<br />
Lösung auf ein mit Kohle bedampftes Kupfernetz aufgetropft