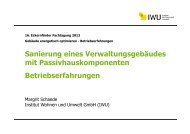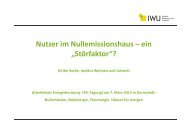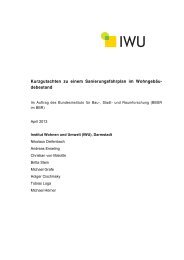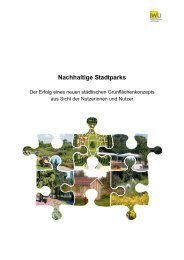Nachhaltiges Bauen - Hessen-Umwelttech
Nachhaltiges Bauen - Hessen-Umwelttech
Nachhaltiges Bauen - Hessen-Umwelttech
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Studie nachhaltiges <strong>Bauen</strong> / Teil 2 Potenziale<br />
Auswirkungen von Baustoffen auf die Gesundheit<br />
Auch schon in früheren Zeiten waren bestimmte Baumaterialien bei ihrer Herstellung und<br />
Verarbeitung mit Gesundheitsgefahren verbunden. Bedeutsame kanzerogene Potenziale<br />
haben z.B. die bei der Bearbeitung entstehenden Stäube bestimmter heimischer Harthöl-<br />
zer 7 (Buche, Eiche) und Steine (Silikate 8 , z.B. Granit). Aber erst die neuere Anwendung<br />
gesundheitsgefährdender Stoffe in Bauprodukten in großen Mengen und vor allem die<br />
verbesserten medizinischen und naturwissenschaftlichen Nachweismethoden haben die<br />
Aufmerksamkeit auf diese Gefahrenpotenziale gelenkt. In die Diskussion geraten waren in<br />
den 80er und 90er Jahren insbesondere:<br />
136<br />
• Asbest 9 ,<br />
• Formaldehyd 10 ,<br />
• polychlorierte Biphenyle (PCB) 11 und Terphenyle (PCT),<br />
• polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK);<br />
• flüchtige organische Verbindungen (volatile organic compounds / VOC),<br />
• die Holzschutzmittel Lindan 12 und<br />
• Pentachlorphenol (PCP 13 ).<br />
Soweit diese Stoffe nicht mittlerweile verboten sind, wie z.B. Asbest und PCP, sind bei<br />
der Verwendung im Bauwesen durch technische Vorgaben für Herstellung und Handhabung<br />
die von ihnen ausgehenden Belastungen der Gesundheit mittlerweile stark reduziert<br />
worden.<br />
Der Weg dahin allerdings ist wegen der vielfältigen wirtschaftlichen Interessen, die mit<br />
Produktion und Anwendung der Stoffe verbunden sind, und wegen der erforderlichen wissenschaftlich<br />
abgesicherten Nachweise des Gefährdungspotenzials äußerst langwierig. Ein<br />
7<br />
Berufskrankheiten-Verordnung vom 31. Oktober 1997, zuletzt geändert 2009, Anlage 1, Zif. 4203 „Adenokarzinome<br />
der Nasenhaupt- und Nasennebenhöhlen durch Stäube von Eichen- oder Buchenholz“<br />
8<br />
Verursacht wird Silikose durch Inhalation und Ablagerung von mineralischem, insbesondere quarzhaltigem<br />
Staub in der Lunge. Silikose ist als Berufskrankheit anerkannt und ist ein Risiko bei der Steinbearbeitung<br />
wie auch z.B. beim Bimsabbau. S. BKV, Anlage 1 Zif. 4101 „Quarzstaublungenerkrankung (Silikose)“ und<br />
4102 „Quarzstaublungenerkrankung in Verbindung mit aktiver Lungentuberkulose (Siliko-Tuberkulose)“<br />
9<br />
Bereits 1943 war Lungenkrebs infolge von Belastungen mit Asbeststaub als Berufskrankheit anerkannt worden;<br />
1970 wurde Asbest in Deutschland als karzinogen anerkannt; seit 1993 ist in Deutschland die Herstellung<br />
asbesthaltiger Produkte und die Verwendung von Asbest verboten, seit 2005 auch EU-weit.<br />
10<br />
Formaldehyd kann Allergien, Haut-, Atemwegs- oder Augenreizungen verursachen. 2004 stufte die Internationale<br />
Agentur für Krebsforschung (IARC) der Weltgesundheitsorganisation WHO die Substanz Formaldehyd<br />
als „krebserregend für den Menschen“ ein. Auch das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) stuft Formaldehyd<br />
mittlerweile auf der Grundlage neuerer Studien als „krebsauslösend für den Menschen“ ein (Bundesinstitut<br />
für Risikobewertung / BfR Pressemitteilung 2004).<br />
11<br />
PCB (Polychlorierte Biphenyle) sind im Bauwesen vor allem in Fugendichtungen enthalten gewesen, aus<br />
denen sie durch Ausgasung in die Umwelt gelangen. 1989 wurde durch die PCB-, PCT-, VC-Verbotsverordnung<br />
das Inverkehrbringen und Verwenden weitgehend verboten. Die Regelungen wurden 1993 in die Chemikalien-Verbotsverordnung<br />
(ChemVerbotsV) übernommen.<br />
PCB wurden in die Liste von zunächst 12 langlebigen organischen Schadstoffen (engl. persistent organic pollutants,<br />
POPs) der Stockholmer Konvention (POP-Konvention) von 2001 aufgenommen, mit der die Stoffe<br />
völkerrechtlich bindenden Verboten bzw. engen Beschränkungen unterliegen. Die Konvention trat 2004 in<br />
Kraft. 2009 wurde sie um neun weitere Stoffe ergänzt, darunter Lindan (γ-Hexachlorcyclohexan), s.u.<br />
12<br />
In Deutschland darf Lindan (Gamma-Hexachlorcyclohexan) seit 1980 nur isomerenrein als Fraß- und Kontaktgift<br />
eingesetzt werden. Lindan wird seit 1984 in der BRD, seit 1989 in der DDR nicht mehr hergestellt.<br />
13<br />
Bereits 1978 waren in Deutschland Kennzeichnungspflichten für PCP-haltige Zubereitungen eingeführt worden.<br />
Im gleichen Jahr wurde für Präparate mit Prüfzeichen des damaligen Instituts für Bautechnik die Anwendung<br />
in Räumen zum dauernden Aufenthalt von Personen untersagt. 1989 wurden dann das Inverkehrbringen<br />
und die Verwendung von PCP und PCP-haltigen Produkten durch die Pentachlorphenolverbotsverordnung<br />
(PCP-V) untersagt, die Regelung wurde dann in die Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV,<br />
1994) übernommen.