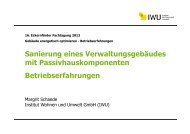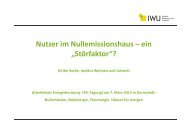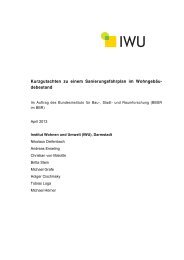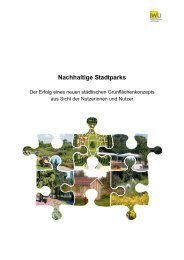Nachhaltiges Bauen - Hessen-Umwelttech
Nachhaltiges Bauen - Hessen-Umwelttech
Nachhaltiges Bauen - Hessen-Umwelttech
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Studie nachhaltiges <strong>Bauen</strong> / Teil 3 Praxis<br />
Graubner et al. 2003, Riegel 2004, Herzog 2005, Renner 2007). Der Lehrstuhlinhaber<br />
Prof. Alexander Graubner war zudem am Aufbau des Zertifizierungssystems von BMVBS<br />
und DGNB mit wissenschaftlicher Grundlagenarbeit beteiligt. Die Kompetenz der Nachhal-<br />
tigkeitszertifizierung wurde einer Ausgründung des Lehrstuhls übertragen, der Life Cycle<br />
Engineering Experts GmbH / LCEE, Darmstadt.<br />
Ähnlich in Kassel, wo das Gebäude mit dem Zentrum für Umweltbewusstes <strong>Bauen</strong> selbst<br />
eine Einrichtung beherbergt, die der Nachhaltigkeit beim <strong>Bauen</strong> institutionell verpflichtet<br />
ist. Beteiligt sind die betreffenden Lehrstühle der Universität Kassel, die sich seit vielen<br />
Jahren mit Energieeinsparung und Ressourcenschonung wissenschaftlich befassen. Ins-<br />
besondere das Konzept zur Optimierung der Energieeffizienz des ZUB-Gebäudes war zu-<br />
gleich Gegenstand eines Forschungsvorhabens verbunden mit einem umfänglichen Mess-<br />
und Auswertungsprogramm unter Leitung von Prof. Gerd Hauser, seinerzeit Inhaber des<br />
Lehrstuhls für Bauphysik an der Uni Kassel (Hauser et al. 2002 und 2004). An den Bera-<br />
tungen des Gebäudekonzepts war zudem Prof. Gernot Minke beteiligt, der 1975 am<br />
Fachbereich Architektur der Universität Kassel das Forschungslabor für Experimentelles<br />
<strong>Bauen</strong> (FEB) gegründet hatte. Auf ihn geht der Vorschlag einer Lehmwand zum Feuchtig-<br />
keits- und Temperaturausgleich im Innern des Gebäudes zurück.<br />
Anders die Situation der Deutschen Bank in Frankfurt. Hier standen immobilienwirtschaft-<br />
liche Überlegungen im Vordergrund. Mit der Erfordernis konfrontiert, das zentrale Verwal-<br />
tungsgebäude der Deutschen Bank in Frankfurt durchgreifend erneuern zu müssen, wur-<br />
den grundlegende Überlegungen angestellt, wie die Betriebskosten nachhaltig gesenkt<br />
und wie eine möglichst hohe Werthaltigkeit der Investition erreicht werden konnten. Für<br />
den Bauherrn, mit institutioneller Kompetenz in internationaler Finanz- und Immobilien-<br />
wirtschaft lag eine Orientierung an einem anerkannt hohen internationalen Bewertungs-<br />
maßstab für die Qualität von Immobilien nahe. Damit kam bei der Sanierung des Gebäu-<br />
des des Frankfurter Firmensitzes das seinerzeit bereits bestehende Zertifizierungssystem<br />
LEED ins Spiel. Angestrebt wird die höchste Stufe der Bewertung, Platin. Die Deutsche<br />
Bank ist aber auch Gründungsmitglied der DGNB. So wird das Gebäude auch nach den<br />
Kriterien der DGNB zertifiziert, ein Vorzertifikat in Gold hat es 2009 bereits erhalten.<br />
Auch für einen Bauherrn mit hoher wirtschaftlicher Kompetenz wie die Deutsche Bank ist<br />
offensichtlich die Verknüpfung von Umweltschutzzielen und sozialen Vorgaben mit dem<br />
Nachweis von Wirtschaftlichkeit und Funktionalität eines Bauvorhabens sehr gut mit der<br />
Unternehmensstrategie zu vereinbaren; der Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und dem Sa-<br />
nierungskonzept der „greentowers“, wird im Internet eine eigene Homepage gewidmet<br />
(www.banking-on-green.com, bzw. www.greentowers.de).<br />
Beispielhaft werden die Ergebnisse der Ökobilanzierung der Referenzgebäude anhand<br />
ausgewählter charakteristischer Bauteile vorgestellt. Den beim Gebäude ausgeführten<br />
Bauteilen werden jeweils Alternativen mit anderem Aufbau der Bauteilschichten gegen-<br />
übergestellt (s. Tab. 3.1-2).<br />
Voraussetzungen bei der Bewertung<br />
Von den Referenzgebäuden waren die beiden Neubauten konzipiert worden, ohne dass an<br />
eine Zertifizierung der Nachhaltigkeit zu denken war; die Zertifizierung erfolgte erst im<br />
Nachhinein. So waren beide Neubauten mehr oder weniger unter den üblichen Bedingun-<br />
gen von Planungs- und Bauprozessen öffentlicher Hochbauten geplant und realisiert wor-<br />
den. Mit der Zertifizierung wird jedoch ein höherer Standard als üblich abgefragt, der sich<br />
zu großen Teilen ohne größeren Aufwand erreichen lässt, aber keineswegs allgemein<br />
165