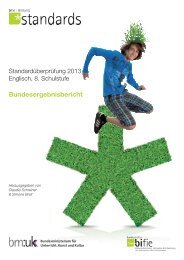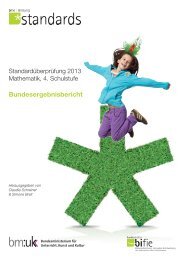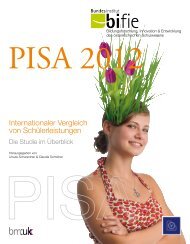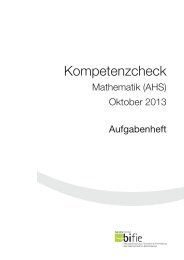- Seite 1 und 2: Der Kompetenzbereich Hörverstehen
- Seite 3 und 4: Eidesstattliche Erklärung Hiermit
- Seite 5 und 6: Zusammenfassung Die vorliegende Mas
- Seite 7 und 8: INHALTSVERZEICHNIS 1. Einleitung 10
- Seite 9 und 10: 4.2 Methoden der Untersuchung 131 4
- Seite 11 und 12: 1. Einleitung 1.1 Ausgangslage - Er
- Seite 13 und 14: Wir haben in ersten Versuchen die E
- Seite 15 und 16: Auswirkung auf die Testleistungen d
- Seite 17 und 18: Kapitel 2 Grundlagen - Theorien 17
- Seite 19: damit verbundenen motivationalen, v
- Seite 23 und 24: wesentliche Informationen akustisch
- Seite 25 und 26: unterscheiden. Bei der akustischen
- Seite 27 und 28: Verarbeitung betrifft, „durch den
- Seite 29 und 30: aufrecht erhalten bleibt und dass d
- Seite 31 und 32: Unbekanntem verknüpft und dass das
- Seite 33 und 34: 2.2 Hörverstehen - Psycholog. Grun
- Seite 35 und 36: Sprachwissen jemand hat (Butkhuzi,
- Seite 37 und 38: 8). Auch hier könnte man wieder da
- Seite 39 und 40: Das Kurzzeitgedächtnis (das breite
- Seite 41 und 42: Bildungsstandards Deutsch der 8. Sc
- Seite 43 und 44: Die Redundanz ist laut Fremdwörter
- Seite 45 und 46: Im Lehrplan der 5. bis 8. Schulstuf
- Seite 47 und 48: denen anschließend die Arbeitsanwe
- Seite 49 und 50: gemeinsames Handeln für eine Gespr
- Seite 51 und 52: können. Ein weiterer Unterschied z
- Seite 53 und 54: 2.3.1 Gesetzeslage - Lehrpläne Wir
- Seite 55 und 56: die Berücksichtigung der individue
- Seite 57 und 58: 5. Klasse Erlebnisse, Erfahrungen,
- Seite 59 und 60: (BIFIE, 2011a). Insgesamt können B
- Seite 61 und 62: Zum Vergleich dazu geht das Schweiz
- Seite 63 und 64: ZZuhören, SSprechen Abbbildung 133
- Seite 65 und 66: Altersgemäße mündliche Texte im
- Seite 67 und 68: SCHHREIBEN (planenn, verfassen, üb
- Seite 69 und 70: Kapitel 3 Das Messen von Hörverste
- Seite 71 und 72:
Tests zur Schulevaluation (auf Eben
- Seite 73 und 74:
mehr auf das Zuhörklima, auf die
- Seite 75 und 76:
des Schülers bei diesem Test zu er
- Seite 77 und 78:
ist im österreichischen Lehrplan u
- Seite 79 und 80:
Objektivität: Ein Test ist dann ob
- Seite 81 und 82:
3.2 Operationalisierung des Konstru
- Seite 83 und 84:
werden muss. Auch hier geht man dav
- Seite 85 und 86:
schriftlicher Form zu bearbeiten si
- Seite 87 und 88:
Lesekompetenz, die Sprechkompetenz,
- Seite 89 und 90:
Wissen, , Kenntnissse und Erfaahrun
- Seite 91 und 92:
Hörtextes zielen. Spezialisiertes
- Seite 93 und 94:
Instrukttionen, einemm Hörtext, ei
- Seite 95 und 96:
Die Einleitung sollte folgende Anga
- Seite 97 und 98:
Hörtexte, Originaltexte) und damit
- Seite 99 und 100:
unterscheiden: Auf der einen Seite
- Seite 101 und 102:
Im Programm von hr2 nehmen wir uns
- Seite 103 und 104:
Umfeld“ (Leben zu Hause, Familie,
- Seite 105 und 106:
77). Jede Frage zum Item 51 richtet
- Seite 107 und 108:
is zu den Fragen, die Schlussfolger
- Seite 109 und 110:
Geschlossene Antwort- Formate Halbo
- Seite 111 und 112:
plausibel, kein Schüler würde die
- Seite 113 und 114:
(„Ätherische Öle und Salben“
- Seite 115 und 116:
Die Schwierigkeit dieses Formates l
- Seite 117 und 118:
Kompettenzen in deem besondeeren Fa
- Seite 119 und 120:
Die dreijährigen Überprüfungen d
- Seite 121 und 122:
Die Präsentation ist (u.a.) abhän
- Seite 123 und 124:
Nachfolgend ein paar Beispiele der
- Seite 125 und 126:
4. Empirische Untersuchung 4.1 Frag
- Seite 127 und 128:
Diese Art der Präsentation hat etl
- Seite 129 und 130:
Vorentlastung Stimulus 1× abspiele
- Seite 131 und 132:
Neben diesen Haupteffekten wurden d
- Seite 133 und 134:
In der UNESCO HS wurden die 17 Sch
- Seite 135 und 136:
Tabelle 3: Klassen/Leistungsgruppen
- Seite 137 und 138:
Tabelle 4: Auswahl der Stimuli und
- Seite 139 und 140:
Tabelle 5: Die vier HV-Aufgaben - F
- Seite 141 und 142:
allgemeinen Instruktion festgehalte
- Seite 143 und 144:
Auch der Testzeitpunkt hatte Einflu
- Seite 145 und 146:
Schüler und weisen eine geringe Tr
- Seite 147 und 148:
Tabelle 7: Charakteristik der Schü
- Seite 149 und 150:
Leistungsgruppe) in Versuchsgruppe
- Seite 151 und 152:
Tabelle 10: Ergebnisse HV-Tests nac
- Seite 153 und 154:
Die Gruppen mit „gelenkter“ Ver
- Seite 155 und 156:
Die Hypothesenprüfung ergibt keine
- Seite 157 und 158:
Hypothese 3: Die kombinierten Grupp
- Seite 159 und 160:
1. Verständlichkeit bezüglich des
- Seite 161 und 162:
4.3.3.2 Ergebnisse Teil 2: Wie ich
- Seite 163 und 164:
42% haben die besten (4), 44% sehr
- Seite 165 und 166:
Die zweimalige Präsentation wurde
- Seite 167 und 168:
esser (3,9 vs. 4,4 „ungelenkt“,
- Seite 169 und 170:
Die vier Items bei Bildung der Skal
- Seite 171 und 172:
Faktor 3: Erfahrungen in der Kindhe
- Seite 173 und 174:
Die Abbildung 50 zeigt deutlich, wi
- Seite 175 und 176:
die Durchführungsobjektivität zuk
- Seite 177 und 178:
Schüler ist hier geringer). Besond
- Seite 179 und 180:
ungelenkt“ bestätigen diese Auss
- Seite 181 und 182:
(2) Bearbeitungszeit: Verbessern m
- Seite 183 und 184:
Kapitel 5 Zusammenfassung und Disku
- Seite 185 und 186:
Fähigkeit des Menschen, erhaltene
- Seite 187 und 188:
Das zweite große Ziel, wichtige Hi
- Seite 189 und 190:
Methodisch Unsere Erkenntnisse in m
- Seite 191 und 192:
Als zusätzliches Ergebnis dieser i
- Seite 193 und 194:
Behrens, U.; Böhme, K. & Krelle, M
- Seite 195 und 196:
Bremerich-Vos, A. (2009). Die Bildu
- Seite 197 und 198:
Lernstandsbestimmung im Fach Deutsc
- Seite 199 und 200:
Lehrplan-Service für das allgemein
- Seite 201 und 202:
Reusser, K. (Hrsg.). (1997). Verste
- Seite 203 und 204:
Willenberg, H. (2007). Kompetenzhan
- Seite 205 und 206:
Abbildung 31: Höraufgabe - Bsp. Ri
- Seite 207 und 208:
9. Abkürzungsverzeichnis HS Haupts
- Seite 209 und 210:
Anhang A-F: Kapitel 3 ANHANG A Hör
- Seite 211 und 212:
ANHANG B Hörbeispiel „Reportage
- Seite 213 und 214:
ANHANG C Beispiel „Einleitung“
- Seite 215 und 216:
Und jetzt die Lösungen: Zu Beispie
- Seite 217 und 218:
Beispiel einer Testfrage Deskriptor
- Seite 219 und 220:
Im Vorfeld Mitzubringende Testmater
- Seite 221 und 222:
Habt ihr die Anweisungen verstanden
- Seite 223 und 224:
223
- Seite 225 und 226:
Schüler - ID TEST HÖRVERSTEHEN FR
- Seite 227 und 228:
WIE DU DEN HÖR-TEST ERLEBT HAST 5)
- Seite 229 und 230:
22) Wie oft kam folgendes in deinem
- Seite 231 und 232:
Schüler fragt bei Lehrer nach Sch
- Seite 233 und 234:
ANHANG H: Wichtige Links http://www
- Seite 235 und 236:
ANHANG I: Zusammenspiel von Lehrpla
- Seite 237 und 238:
Regulation des Selbst: Schüler en
- Seite 239 und 240:
ANHANG K: CEFR Raster 71 (Zuhören)
- Seite 241 und 242:
AUFGABENEIGENSCHAFTEN Item-Typen F
- Seite 243 und 244:
ANHANG M: Anregungen zur Umsetzung
- Seite 245 und 246:
Zu den Deskriptoren hat das BIFIE (
- Seite 247 und 248:
damit sie in weiterer Folge auch de
- Seite 249 und 250:
Beim „Schlecht zuhören“ (Behre
- Seite 251 und 252:
ANHANG O: „Verkehrshinweis“ (H