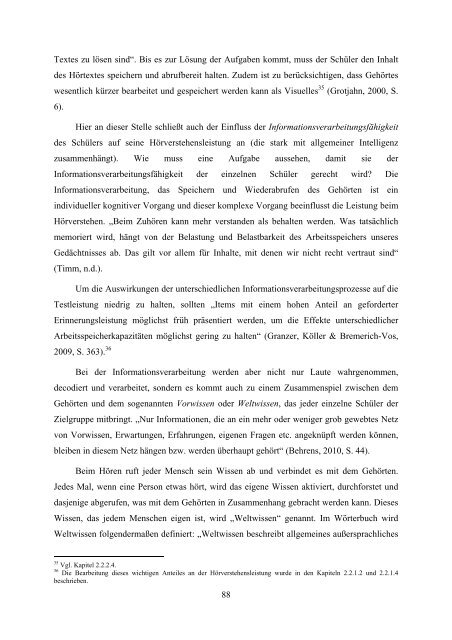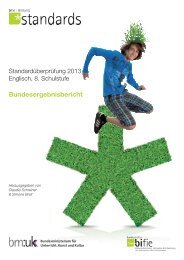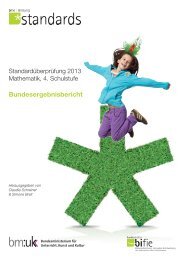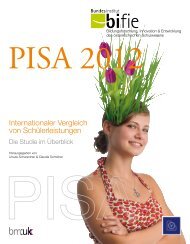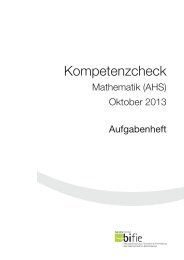Masterarbeit Hörverstehen - Bifie
Masterarbeit Hörverstehen - Bifie
Masterarbeit Hörverstehen - Bifie
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Textes zu lösen sind“. Bis es zur Lösung der Aufgaben kommt, muss der Schüler den Inhalt<br />
des Hörtextes speichern und abrufbereit halten. Zudem ist zu berücksichtigen, dass Gehörtes<br />
wesentlich kürzer bearbeitet und gespeichert werden kann als Visuelles 35 (Grotjahn, 2000, S.<br />
6).<br />
Hier an dieser Stelle schließt auch der Einfluss der Informationsverarbeitungsfähigkeit<br />
des Schülers auf seine <strong>Hörverstehen</strong>sleistung an (die stark mit allgemeiner Intelligenz<br />
zusammenhängt). Wie muss eine Aufgabe aussehen, damit sie der<br />
Informationsverarbeitungsfähigkeit der einzelnen Schüler gerecht wird? Die<br />
Informationsverarbeitung, das Speichern und Wiederabrufen des Gehörten ist ein<br />
individueller kognitiver Vorgang und dieser komplexe Vorgang beeinflusst die Leistung beim<br />
<strong>Hörverstehen</strong>. „Beim Zuhören kann mehr verstanden als behalten werden. Was tatsächlich<br />
memoriert wird, hängt von der Belastung und Belastbarkeit des Arbeitsspeichers unseres<br />
Gedächtnisses ab. Das gilt vor allem für Inhalte, mit denen wir nicht recht vertraut sind“<br />
(Timm, n.d.).<br />
Um die Auswirkungen der unterschiedlichen Informationsverarbeitungsprozesse auf die<br />
Testleistung niedrig zu halten, sollten „Items mit einem hohen Anteil an geforderter<br />
Erinnerungsleistung möglichst früh präsentiert werden, um die Effekte unterschiedlicher<br />
Arbeitsspeicherkapazitäten möglichst gering zu halten“ (Granzer, Köller & Bremerich-Vos,<br />
2009, S. 363). 36<br />
Bei der Informationsverarbeitung werden aber nicht nur Laute wahrgenommen,<br />
decodiert und verarbeitet, sondern es kommt auch zu einem Zusammenspiel zwischen dem<br />
Gehörten und dem sogenannten Vorwissen oder Weltwissen, das jeder einzelne Schüler der<br />
Zielgruppe mitbringt. „Nur Informationen, die an ein mehr oder weniger grob gewebtes Netz<br />
von Vorwissen, Erwartungen, Erfahrungen, eigenen Fragen etc. angeknüpft werden können,<br />
bleiben in diesem Netz hängen bzw. werden überhaupt gehört“ (Behrens, 2010, S. 44).<br />
Beim Hören ruft jeder Mensch sein Wissen ab und verbindet es mit dem Gehörten.<br />
Jedes Mal, wenn eine Person etwas hört, wird das eigene Wissen aktiviert, durchforstet und<br />
dasjenige abgerufen, was mit dem Gehörten in Zusammenhang gebracht werden kann. Dieses<br />
Wissen, das jedem Menschen eigen ist, wird „Weltwissen“ genannt. Im Wörterbuch wird<br />
Weltwissen folgendermaßen definiert: „Weltwissen beschreibt allgemeines außersprachliches<br />
35<br />
Vgl. Kapitel 2.2.2.4.<br />
36<br />
Die Bearbeitung dieses wichtigen Anteiles an der <strong>Hörverstehen</strong>sleistung wurde in den Kapiteln 2.2.1.2 und 2.2.1.4<br />
beschrieben.<br />
88