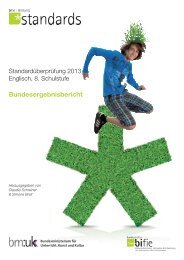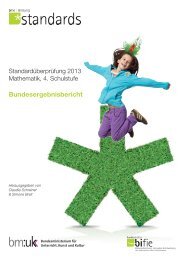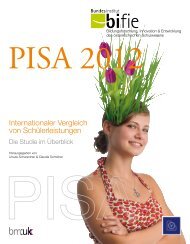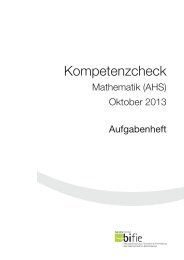Masterarbeit Hörverstehen - Bifie
Masterarbeit Hörverstehen - Bifie
Masterarbeit Hörverstehen - Bifie
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2.3 <strong>Hörverstehen</strong> im Unterricht der Sekundarstufe I<br />
Schüler hören in der Schule zu, um einen Arbeitsauftrag zu erfüllen, sie hören zu, um Fragen<br />
zu beantworten, sie hören zu, um das Diktat niederzuschreiben, sie lauschen dem<br />
interessanten Lehrervortrag, sie „überhören“, dass sie zuhören sollen, sie hören zu und<br />
gehorchen, sie hören nicht mehr zu, wenn sie schon zu viel gehört haben oder es langweilig<br />
ist und sie hören den ersehnten Pausengong. Unsere Schüler sind in der Schule die meiste Zeit<br />
in der Situation des Zuhörens - meist im Sinne von „dem Lehrer Zuhören“ - und doch wird<br />
dieser zentralen Kompetenz als Lehr- und Lerngegenstand laut Krelle (2010, S. 51)<br />
„vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit geschenkt“.<br />
Das <strong>Hörverstehen</strong> ist im Lehrplan lediglich unter der Rubrik „Sprache“ mit definiert<br />
und im Kompetenzmodell ist es mit dem Sprechen mit erwähnt (vgl. Kap. 2.3.1.2). Dabei ist<br />
das Zuhören/<strong>Hörverstehen</strong> neben dem Schreiben und dem Lesen laut Esterl und Zeitlinger<br />
(2008, S. 5) „die dritte basale Kompetenz, die in der schulischen Bildung gelehrt und vertieft<br />
werden soll“ und es ist außerdem die Voraussetzung und das Bindeglied für den<br />
Spracherwerb, den mündlichen Sprachgebrauch und für den Schriftspracherwerb (Hagen,<br />
2006, S. 24). Auch nach Glaboniat (2008, S. 52) ist das <strong>Hörverstehen</strong> „ein sehr komplexes<br />
Zusammenspiel von (neuro-) physiologischen, mentalen und kognitiven Faktoren“.<br />
In den Lehrplänen der 5. bis 8. Schulstufe und in der didaktischen Literatur ist der<br />
Stellenwert des <strong>Hörverstehen</strong>s trotzdem unübersehbar vernachlässigt bzw. wird ihm kein<br />
Eigenwert zugesprochen. Lesen, Schreiben und Sprechen sind in den traditionellen<br />
Handlungsfeldern des Deutschunterrichts bestimmend (Leubolt, 2008, S. 10). Im<br />
Taschenbuch des Deutschunterrichts (Lange, 1994, S. 416) sind unter der Überschrift<br />
Hörfunk und Fernsehen gerade mal drei Seiten zu diesem Thema zu finden. Obwohl Seite 418<br />
der Satz „Die stärkste Wahrnehmungsfülle des Menschen sitzt sozusagen im Ohr“ steht, ist<br />
leider auch hier kein ausführlicher und tiefergreifender Ansatz zu finden.<br />
Wermke (1995, S. 7) nennt als Hauptursachen für diese defizitäre Situation „die<br />
Dominanz der visuellen Kommunikation bei der Öffnung des Deutschunterrichts für<br />
Massenmedien und Alltag während der letzten 25 Jahre“. Zusätzlich erwähnt sie noch den<br />
„kurzatmigen Kommunikationsansatz als Gliederungsprinzip der Lernbereiche“ und dass es<br />
einen gewissen Druck gibt, vorzeigbare Lernergebnisse und Beurteilungen nachvollziehbar<br />
vorzuweisen (Hagen, 2006, S. 24). 9<br />
9 Um die Hörästhetik zu unterstützen und voranzutreiben kann man im Ausblick bzw. Anhang M mehr dazu nachlesen.<br />
52