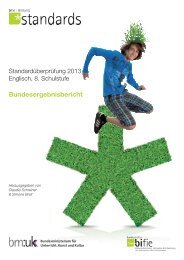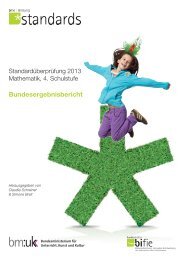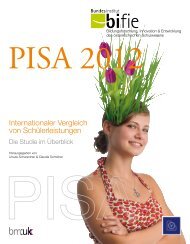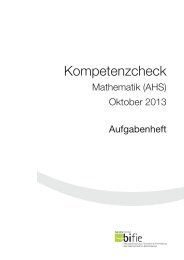Masterarbeit Hörverstehen - Bifie
Masterarbeit Hörverstehen - Bifie
Masterarbeit Hörverstehen - Bifie
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Unbekanntem verknüpft und dass das Gehörte aufgrund des persönlichen Weltwissens bzw.<br />
Hörmusters interpretiert wird. Behrens und Eriksson (2009, S. 52) erwähnen zusätzlich, dass<br />
gutes <strong>Hörverstehen</strong> auch die Fähigkeit inkludiert, mit dem gehörten Text „in ein emotionales<br />
Verhältnis zu treten“, das heißt, dass Schüler sich mit dem Gehörten identifizieren, es<br />
akzeptieren oder negieren ( Reaktion, Abb. 4) können. Dieser letzte Schritt macht, wie<br />
schon im letzten Abschnitt erwähnt, den Unterschied zwischen „nur“ Zuhören und<br />
<strong>Hörverstehen</strong> aus.<br />
Nach unserer Sichtweise können die oben genannten Vorgänge Solmeckes und Behrens<br />
gleichgesetzt werden mit dem Begriff der „Produktion“ des Stufenmodells von Geißner (Abb.<br />
4), der das <strong>Hörverstehen</strong> und das situationsspezifische Hörhandeln impliziert.<br />
Die Grenzen zwischen den Begriffen Zuhören und <strong>Hörverstehen</strong> sind in der Literatur<br />
fließend. Es scheint auch eine Problematik der deutschen Sprache zu sein, dass es keine<br />
eigenen Ausdrücke für das verstehende oder aufmerksame Zuhören gibt. Im Englischen gibt<br />
es zum Beispiel „attend“ für diese vorher erwähnten Ausdrücke. Sprechwissenschaftler<br />
sprechen hier von <strong>Hörverstehen</strong> (Pabst-Weinschenk, 2011, S. 58f).<br />
Im Lehrplan Deutsch für die 4. Schulstufe der Volksschule ist die Rede von<br />
„verstehend, aufmerksam und respektvoll zuhören“ und im Bereich der Hauptschule wird im<br />
Lehrplan von der Fähigkeit gesprochen, aus „Gehörtem Informationen zu entnehmen“ (vgl.<br />
Kap. 2.3.1.1). Lediglich in den Bildungsstandards der 8. Schulstufe ist das Zuhören als<br />
eigener Kompetenzbereich verankert.<br />
Konkret vom <strong>Hörverstehen</strong> wird nur im Bereich Deutsch als Zweitsprache oder bei<br />
einer lebenden Fremdsprache gesprochen. Hier hat das <strong>Hörverstehen</strong> seinen ausdrücklichen<br />
Platz. Manche Sprachbücher für den Deutschunterricht, z.B. „Mit eigenen Worten“ (Merkos,<br />
2000, S. 43) oder „Wissen und Können“ (Hoppe, 2006) widmen dem Hören schon eigene<br />
Kapitel. Insgesamt haben aber die Hörmedien in der didaktischen Literatur kaum Resonanz<br />
gefunden (Wermke, 1996, S. 4) und es scheint an der Zeit zu sein, das Ungleichgewicht<br />
zwischen visuellen und den Hörmedien auszugleichen.<br />
Die <strong>Hörverstehen</strong>skompetenz benötigt somit viele verschiedene Einzelkompetenzen.<br />
Diese sind laut Imhof (2004, S. 151) „motivationale und volitive Prozesse, emotionale<br />
Regulierung, Konzentration und Aufmerksamkeit, Sprachverstehen, Gedächtnis, Denken,<br />
visuelle Wahrnehmung, soziale Wahrnehmung“. Die einzelnen Kompetenzen bauen<br />
31