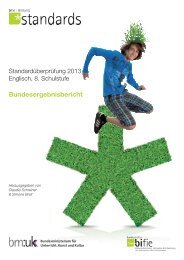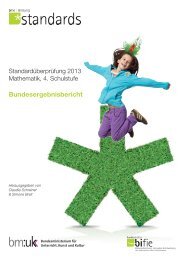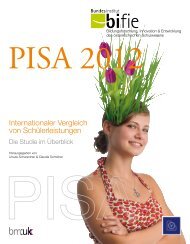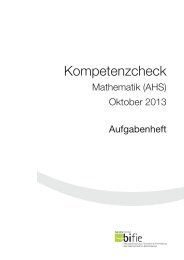Masterarbeit Hörverstehen - Bifie
Masterarbeit Hörverstehen - Bifie
Masterarbeit Hörverstehen - Bifie
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
gemeinsames Handeln für eine Gesprächssituation gibt (Nold & De Jong, 2007, S. 245) und<br />
sie werden laut Nodari (2001, S.11) im Gegensatz zum Leseverstehen und Schreiben selten in<br />
der Schriftsprache, sondern meist im Dialekt erlebt. Zusätzlich ist noch zu erwähnen, dass das<br />
Sprechen, genau wie das <strong>Hörverstehen</strong>, „durch eine hohe kognitive Beanspruchung<br />
gekennzeichnet“ (Imhof, 2003, S. 201) ist.<br />
Es gibt mittlerweile viel Literatur zum Thema Kommunikation. Friedemann Schulz von<br />
Thun („Miteinander reden“, 1995), Marita Pabst-Weinschenk („Grundlagen der<br />
Sprechwissenschaft oder Sprecherziehung“, 2011), Winfried Ulrich („Mündliche<br />
Kommunikation und Gesprächsdidaktik“, 2009) oder Heinz Klippert<br />
(„Kommunikationstraining“, 2007) haben schon Lehr- und Lernformen zu diesem Thema<br />
entwickelt. Deswegen wird hier nicht weiter darauf eingegangen, sondern im Mittelpunkt<br />
stehen die Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten zwischen der <strong>Hörverstehen</strong>s- und<br />
Sprechkompetenz. Dies hier auch nur begrenzt, da Sprechkompetenz nicht der<br />
Untersuchungsgegenstand ist.<br />
Es stellt sich die Frage, ob man Zuhören und Sprechen als gemeinsamen<br />
Untersuchungsgegenstand unter Sprachverstehen zusammenfassen könnte oder ob es<br />
sinnvoller wäre, von Anfang an beide Bereiche als selbständige, voneinander abgrenzbare<br />
Kompetenzbereiche zu sehen (Imhof, 2003, S. 21). Imhof (2004, S. 11) betont, dass beim<br />
Sprechen und Zuhören, ebenso wie beim Lesen und Schreiben, immer zwei Seiten „einer<br />
Medaille“ zu betrachten sind. Beide Teile müssen getrennt gesehen und erworben werden,<br />
obwohl sie in den meisten Situationen untrennbar miteinander verbunden sind (Eschbacher,<br />
2010, S. 47). Man kann zum Beispiel nicht gut miteinander kommunizieren, wenn man<br />
einander nicht ausreichend zuhört (Koch, 2010, S. 322).<br />
Ein grundlegender Unterschied zwischen dem <strong>Hörverstehen</strong> und dem Sprechen ist, dass<br />
man zumindest die Situation des Sprechens beobachten kann (Grotjahn, 2005, S.116). Wie<br />
schon erwähnt, kann man nicht erkennen, wie der Zuhörer in der Situation kognitiv arbeitet<br />
und wie das Ergebnis zustande kommt. Sprechen ist gekennzeichnet durch die Flüchtigkeit<br />
des Gesprochenen, die geringe Verbindlichkeit des Textes, die Möglichkeit des sofortigen<br />
Rückmeldens auf eine Äußerung, durch den Einsatz von Stimme, Gestik und Mimik, durch<br />
die Notwendigkeit höherer Spontanität und durch die Situation, in der das Sprechen stattfindet<br />
(Berger, 2010, S. 6-13). Aufgrund dieser Merkmale kann man erkennen, dass hier, genauso<br />
wie beim Überprüfen des <strong>Hörverstehen</strong>s, ein besonderes „Verfahren der Vermittlung und<br />
Messung“ (Becker-Mrotzek, 2008, S. 1) notwendig ist, um valide Ergebnisse zu erhalten.<br />
49