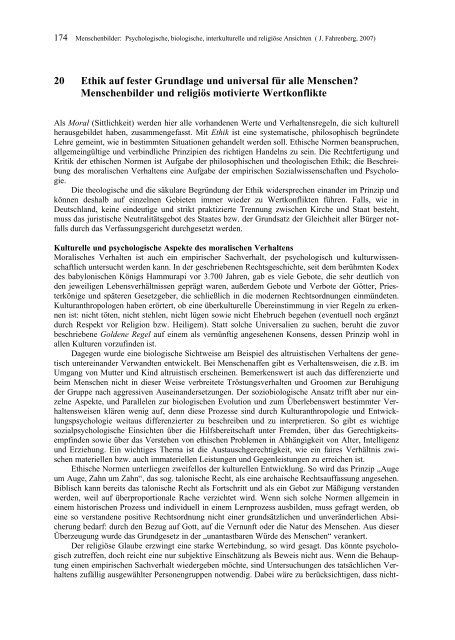Menschenbilder - Jochen Fahrenberg
Menschenbilder - Jochen Fahrenberg
Menschenbilder - Jochen Fahrenberg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
174 <strong>Menschenbilder</strong>: Psychologische, biologische, interkulturelle und religiöse Ansichten ( J. <strong>Fahrenberg</strong>, 2007)<br />
20 Ethik auf fester Grundlage und universal für alle Menschen?<br />
<strong>Menschenbilder</strong> und religiös motivierte Wertkonflikte<br />
Als Moral (Sittlichkeit) werden hier alle vorhandenen Werte und Verhaltensregeln, die sich kulturell<br />
herausgebildet haben, zusammengefasst. Mit Ethik ist eine systematische, philosophisch begründete<br />
Lehre gemeint, wie in bestimmten Situationen gehandelt werden soll. Ethische Normen beanspruchen,<br />
allgemeingültige und verbindliche Prinzipien des richtigen Handelns zu sein. Die Rechtfertigung und<br />
Kritik der ethischen Normen ist Aufgabe der philosophischen und theologischen Ethik; die Beschreibung<br />
des moralischen Verhaltens eine Aufgabe der empirischen Sozialwissenschaften und Psychologie.<br />
Die theologische und die säkulare Begründung der Ethik widersprechen einander im Prinzip und<br />
können deshalb auf einzelnen Gebieten immer wieder zu Wertkonflikten führen. Falls, wie in<br />
Deutschland, keine eindeutige und strikt praktizierte Trennung zwischen Kirche und Staat besteht,<br />
muss das juristische Neutralitätsgebot des Staates bzw. der Grundsatz der Gleichheit aller Bürger notfalls<br />
durch das Verfassungsgericht durchgesetzt werden.<br />
Kulturelle und psychologische Aspekte des moralischen Verhaltens<br />
Moralisches Verhalten ist auch ein empirischer Sachverhalt, der psychologisch und kulturwissenschaftlich<br />
untersucht werden kann. In der geschriebenen Rechtsgeschichte, seit dem berühmten Kodex<br />
des babylonischen Königs Hammurapi vor 3.700 Jahren, gab es viele Gebote, die sehr deutlich von<br />
den jeweiligen Lebensverhältnissen geprägt waren, außerdem Gebote und Verbote der Götter, Priesterkönige<br />
und späteren Gesetzgeber, die schließlich in die modernen Rechtsordnungen einmündeten.<br />
Kulturanthropologen haben erörtert, ob eine überkulturelle Übereinstimmung in vier Regeln zu erkennen<br />
ist: nicht töten, nicht stehlen, nicht lügen sowie nicht Ehebruch begehen (eventuell noch ergänzt<br />
durch Respekt vor Religion bzw. Heiligem). Statt solche Universalien zu suchen, beruht die zuvor<br />
beschriebene Goldene Regel auf einem als vernünftig angesehenen Konsens, dessen Prinzip wohl in<br />
allen Kulturen vorzufinden ist.<br />
Dagegen wurde eine biologische Sichtweise am Beispiel des altruistischen Verhaltens der genetisch<br />
untereinander Verwandten entwickelt. Bei Menschenaffen gibt es Verhaltensweisen, die z.B. im<br />
Umgang von Mutter und Kind altruistisch erscheinen. Bemerkenswert ist auch das differenzierte und<br />
beim Menschen nicht in dieser Weise verbreitete Tröstungsverhalten und Groomen zur Beruhigung<br />
der Gruppe nach aggressiven Auseinandersetzungen. Der soziobiologische Ansatz trifft aber nur einzelne<br />
Aspekte, und Parallelen zur biologischen Evolution und zum Überlebenswert bestimmter Verhaltensweisen<br />
klären wenig auf, denn diese Prozesse sind durch Kulturanthropologie und Entwicklungspsychologie<br />
weitaus differenzierter zu beschreiben und zu interpretieren. So gibt es wichtige<br />
sozialpsychologische Einsichten über die Hilfsbereitschaft unter Fremden, über das Gerechtigkeitsempfinden<br />
sowie über das Verstehen von ethischen Problemen in Abhängigkeit von Alter, Intelligenz<br />
und Erziehung. Ein wichtiges Thema ist die Austauschgerechtigkeit, wie ein faires Verhältnis zwischen<br />
materiellen bzw. auch immateriellen Leistungen und Gegenleistungen zu erreichen ist.<br />
Ethische Normen unterliegen zweifellos der kulturellen Entwicklung. So wird das Prinzip „Auge<br />
um Auge, Zahn um Zahn“, das sog. talonische Recht, als eine archaische Rechtsauffassung angesehen.<br />
Biblisch kann bereits das talonische Recht als Fortschritt und als ein Gebot zur Mäßigung verstanden<br />
werden, weil auf überproportionale Rache verzichtet wird. Wenn sich solche Normen allgemein in<br />
einem historischen Prozess und individuell in einem Lernprozess ausbilden, muss gefragt werden, ob<br />
eine so verstandene positive Rechtsordnung nicht einer grundsätzlichen und unveränderlichen Absicherung<br />
bedarf: durch den Bezug auf Gott, auf die Vernunft oder die Natur des Menschen. Aus dieser<br />
Überzeugung wurde das Grundgesetz in der „unantastbaren Würde des Menschen“ verankert.<br />
Der religiöse Glaube erzwingt eine starke Wertebindung, so wird gesagt. Das könnte psychologisch<br />
zutreffen, doch reicht eine nur subjektive Einschätzung als Beweis nicht aus. Wenn die Behauptung<br />
einen empirischen Sachverhalt wiedergeben möchte, sind Untersuchungen des tatsächlichen Verhaltens<br />
zufällig ausgewählter Personengruppen notwendig. Dabei wäre zu berücksichtigen, dass nicht-