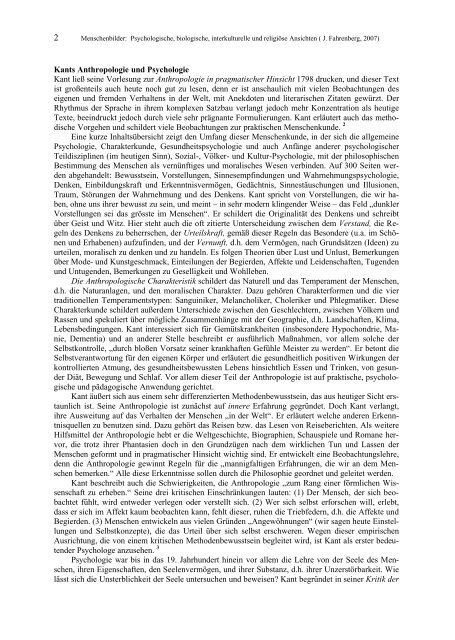Menschenbilder - Jochen Fahrenberg
Menschenbilder - Jochen Fahrenberg
Menschenbilder - Jochen Fahrenberg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2 <strong>Menschenbilder</strong>: Psychologische, biologische, interkulturelle und religiöse Ansichten ( J. <strong>Fahrenberg</strong>, 2007)<br />
Kants Anthropologie und Psychologie<br />
Kant ließ seine Vorlesung zur Anthropologie in pragmatischer Hinsicht 1798 drucken, und dieser Text<br />
ist großenteils auch heute noch gut zu lesen, denn er ist anschaulich mit vielen Beobachtungen des<br />
eigenen und fremden Verhaltens in der Welt, mit Anekdoten und literarischen Zitaten gewürzt. Der<br />
Rhythmus der Sprache in ihrem komplexen Satzbau verlangt jedoch mehr Konzentration als heutige<br />
Texte, beeindruckt jedoch durch viele sehr prägnante Formulierungen. Kant erläutert auch das methodische<br />
Vorgehen und schildert viele Beobachtungen zur praktischen Menschenkunde. 2<br />
Eine kurze Inhaltsübersicht zeigt den Umfang dieser Menschenkunde, in der sich die allgemeine<br />
Psychologie, Charakterkunde, Gesundheitspsychologie und auch Anfänge anderer psychologischer<br />
Teildisziplinen (im heutigen Sinn), Sozial-, Völker- und Kultur-Psychologie, mit der philosophischen<br />
Bestimmung des Menschen als vernünftiges und moralisches Wesen verbinden. Auf 300 Seiten werden<br />
abgehandelt: Bewusstsein, Vorstellungen, Sinnesempfindungen und Wahrnehmungspsychologie,<br />
Denken, Einbildungskraft und Erkenntnisvermögen, Gedächtnis, Sinnestäuschungen und Illusionen,<br />
Traum, Störungen der Wahrnehmung und des Denkens. Kant spricht von Vorstellungen, die wir haben,<br />
ohne uns ihrer bewusst zu sein, und meint – in sehr modern klingender Weise – das Feld „dunkler<br />
Vorstellungen sei das grösste im Menschen“. Er schildert die Originalität des Denkens und schreibt<br />
über Geist und Witz. Hier steht auch die oft zitierte Unterscheidung zwischen dem Verstand, die Regeln<br />
des Denkens zu beherrschen, der Urteilskraft, gemäß dieser Regeln das Besondere (u.a. im Schönen<br />
und Erhabenen) aufzufinden, und der Vernunft, d.h. dem Vermögen, nach Grundsätzen (Ideen) zu<br />
urteilen, moralisch zu denken und zu handeln. Es folgen Theorien über Lust und Unlust, Bemerkungen<br />
über Mode- und Kunstgeschmack, Einteilungen der Begierden, Affekte und Leidenschaften, Tugenden<br />
und Untugenden, Bemerkungen zu Geselligkeit und Wohlleben.<br />
Die Anthropologische Charakteristik schildert das Naturell und das Temperament der Menschen,<br />
d.h. die Naturanlagen, und den moralischen Charakter. Dazu gehören Charakterformen und die vier<br />
traditionellen Temperamentstypen: Sanguiniker, Melancholiker, Choleriker und Phlegmatiker. Diese<br />
Charakterkunde schildert außerdem Unterschiede zwischen den Geschlechtern, zwischen Völkern und<br />
Rassen und spekuliert über mögliche Zusammenhänge mit der Geographie, d.h. Landschaften, Klima,<br />
Lebensbedingungen. Kant interessiert sich für Gemütskrankheiten (insbesondere Hypochondrie, Manie,<br />
Dementia) und an anderer Stelle beschreibt er ausführlich Maßnahmen, vor allem solche der<br />
Selbstkontrolle, „durch bloßen Vorsatz seiner krankhaften Gefühle Meister zu werden“. Er betont die<br />
Selbstverantwortung für den eigenen Körper und erläutert die gesundheitlich positiven Wirkungen der<br />
kontrollierten Atmung, des gesundheitsbewussten Lebens hinsichtlich Essen und Trinken, von gesunder<br />
Diät, Bewegung und Schlaf. Vor allem dieser Teil der Anthropologie ist auf praktische, psychologische<br />
und pädagogische Anwendung gerichtet.<br />
Kant äußert sich aus einem sehr differenzierten Methodenbewusstsein, das aus heutiger Sicht erstaunlich<br />
ist. Seine Anthropologie ist zunächst auf innere Erfahrung gegründet. Doch Kant verlangt,<br />
ihre Ausweitung auf das Verhalten der Menschen „in der Welt“. Er erläutert welche anderen Erkenntnisquellen<br />
zu benutzen sind. Dazu gehört das Reisen bzw. das Lesen von Reiseberichten. Als weitere<br />
Hilfsmittel der Anthropologie hebt er die Weltgeschichte, Biographien, Schauspiele und Romane hervor,<br />
die trotz ihrer Phantasien doch in den Grundzügen nach dem wirklichen Tun und Lassen der<br />
Menschen geformt und in pragmatischer Hinsicht wichtig sind. Er entwickelt eine Beobachtungslehre,<br />
denn die Anthropologie gewinnt Regeln für die „mannigfaltigen Erfahrungen, die wir an dem Menschen<br />
bemerken.“ Alle diese Erkenntnisse sollen durch die Philosophie geordnet und geleitet werden.<br />
Kant beschreibt auch die Schwierigkeiten, die Anthropologie „zum Rang einer förmlichen Wissenschaft<br />
zu erheben.“ Seine drei kritischen Einschränkungen lauten: (1) Der Mensch, der sich beobachtet<br />
fühlt, wird entweder verlegen oder verstellt sich. (2) Wer sich selbst erforschen will, erlebt,<br />
dass er sich im Affekt kaum beobachten kann, fehlt dieser, ruhen die Triebfedern, d.h. die Affekte und<br />
Begierden. (3) Menschen entwickeln aus vielen Gründen „Angewöhnungen“ (wir sagen heute Einstellungen<br />
und Selbstkonzepte), die das Urteil über sich selbst erschweren. Wegen dieser empirischen<br />
Ausrichtung, die von einem kritischen Methodenbewusstsein begleitet wird, ist Kant als erster bedeutender<br />
Psychologe anzusehen. 3<br />
Psychologie war bis in das 19. Jahrhundert hinein vor allem die Lehre von der Seele des Menschen,<br />
ihren Eigenschaften, den Seelenvermögen, und ihrer Substanz, d.h. ihrer Unzerstörbarkeit. Wie<br />
lässt sich die Unsterblichkeit der Seele untersuchen und beweisen? Kant begründet in seiner Kritik der