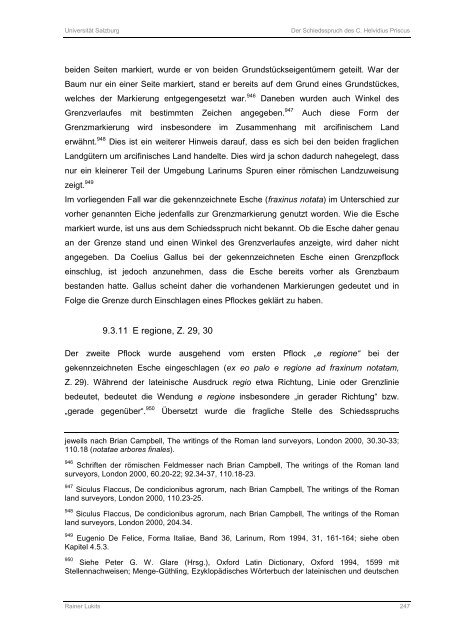Der Schiedsspruch des C. Helvidius Priscus - Heinrich Graf ...
Der Schiedsspruch des C. Helvidius Priscus - Heinrich Graf ...
Der Schiedsspruch des C. Helvidius Priscus - Heinrich Graf ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Universität Salzburg <strong>Der</strong> <strong>Schiedsspruch</strong> <strong>des</strong> C. <strong>Helvidius</strong> <strong>Priscus</strong><br />
beiden Seiten markiert, wurde er von beiden Grundstückseigentümern geteilt. War der<br />
Baum nur ein einer Seite markiert, stand er bereits auf dem Grund eines Grundstückes,<br />
welches der Markierung entgegengesetzt war. 946 Daneben wurden auch Winkel <strong>des</strong><br />
Grenzverlaufes mit bestimmten Zeichen angegeben. 947 Auch diese Form der<br />
Grenzmarkierung wird insbesondere im Zusammenhang mit arcifinischem Land<br />
erwähnt. 948 Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, dass es sich bei den beiden fraglichen<br />
Landgütern um arcifinisches Land handelte. Dies wird ja schon dadurch nahegelegt, dass<br />
nur ein kleinerer Teil der Umgebung Larinums Spuren einer römischen Landzuweisung<br />
zeigt. 949<br />
Im vorliegenden Fall war die gekennzeichnete Esche (fraxinus notata) im Unterschied zur<br />
vorher genannten Eiche jedenfalls zur Grenzmarkierung genutzt worden. Wie die Esche<br />
markiert wurde, ist uns aus dem <strong>Schiedsspruch</strong> nicht bekannt. Ob die Esche daher genau<br />
an der Grenze stand und einen Winkel <strong>des</strong> Grenzverlaufes anzeigte, wird daher nicht<br />
angegeben. Da Coelius Gallus bei der gekennzeichneten Esche einen Grenzpflock<br />
einschlug, ist jedoch anzunehmen, dass die Esche bereits vorher als Grenzbaum<br />
bestanden hatte. Gallus scheint daher die vorhandenen Markierungen gedeutet und in<br />
Folge die Grenze durch Einschlagen eines Pflockes geklärt zu haben.<br />
9.3.11 E regione, Z. 29, 30<br />
<strong>Der</strong> zweite Pflock wurde ausgehend vom ersten Pflock „e regione“ bei der<br />
gekennzeichneten Esche eingeschlagen (ex eo palo e regione ad fraxinum notatam,<br />
Z. 29). Während der lateinische Ausdruck regio etwa Richtung, Linie oder Grenzlinie<br />
bedeutet, bedeutet die Wendung e regione insbesondere „in gerader Richtung“ bzw.<br />
„gerade gegenüber“. 950 Übersetzt wurde die fragliche Stelle <strong>des</strong> <strong>Schiedsspruch</strong>s<br />
jeweils nach Brian Campbell, The writings of the Roman land surveyors, London 2000, 30.30-33;<br />
110.18 (notatae arbores finales).<br />
946 Schriften der römischen Feldmesser nach Brian Campbell, The writings of the Roman land<br />
surveyors, London 2000, 60.20-22; 92.34-37, 110.18-23.<br />
947 Siculus Flaccus, De condicionibus agrorum, nach Brian Campbell, The writings of the Roman<br />
land surveyors, London 2000, 110.23-25.<br />
948 Siculus Flaccus, De condicionibus agrorum, nach Brian Campbell, The writings of the Roman<br />
land surveyors, London 2000, 204.34.<br />
949 Eugenio De Felice, Forma Italiae, Band 36, Larinum, Rom 1994, 31, 161-164; siehe oben<br />
Kapitel 4.5.3.<br />
950 Siehe Peter G. W. Glare (Hrsg.), Oxford Latin Dictionary, Oxford 1994, 1599 mit<br />
Stellennachweisen; Menge-Güthling, Ezyklopädisches Wörterbuch der lateinischen und deutschen<br />
Rainer Lukits 247