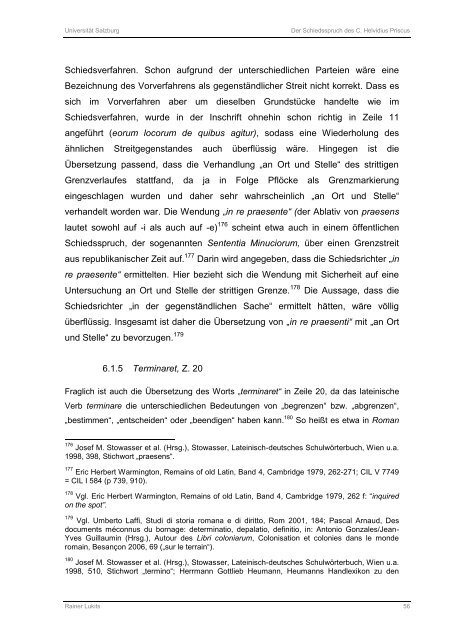Der Schiedsspruch des C. Helvidius Priscus - Heinrich Graf ...
Der Schiedsspruch des C. Helvidius Priscus - Heinrich Graf ...
Der Schiedsspruch des C. Helvidius Priscus - Heinrich Graf ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Universität Salzburg <strong>Der</strong> <strong>Schiedsspruch</strong> <strong>des</strong> C. <strong>Helvidius</strong> <strong>Priscus</strong><br />
Schiedsverfahren. Schon aufgrund der unterschiedlichen Parteien wäre eine<br />
Bezeichnung <strong>des</strong> Vorverfahrens als gegenständlicher Streit nicht korrekt. Dass es<br />
sich im Vorverfahren aber um dieselben Grundstücke handelte wie im<br />
Schiedsverfahren, wurde in der Inschrift ohnehin schon richtig in Zeile 11<br />
angeführt (eorum locorum de quibus agitur), sodass eine Wiederholung <strong>des</strong><br />
ähnlichen Streitgegenstan<strong>des</strong> auch überflüssig wäre. Hingegen ist die<br />
Übersetzung passend, dass die Verhandlung „an Ort und Stelle“ <strong>des</strong> strittigen<br />
Grenzverlaufes stattfand, da ja in Folge Pflöcke als Grenzmarkierung<br />
eingeschlagen wurden und daher sehr wahrscheinlich „an Ort und Stelle“<br />
verhandelt worden war. Die Wendung „in re praesente“ (der Ablativ von praesens<br />
lautet sowohl auf -i als auch auf -e) 176 scheint etwa auch in einem öffentlichen<br />
<strong>Schiedsspruch</strong>, der sogenannten Sententia Minuciorum, über einen Grenzstreit<br />
aus republikanischer Zeit auf. 177 Darin wird angegeben, dass die Schiedsrichter „in<br />
re praesente“ ermittelten. Hier bezieht sich die Wendung mit Sicherheit auf eine<br />
Untersuchung an Ort und Stelle der strittigen Grenze. 178 Die Aussage, dass die<br />
Schiedsrichter „in der gegenständlichen Sache“ ermittelt hätten, wäre völlig<br />
überflüssig. Insgesamt ist daher die Übersetzung von „in re praesenti“ mit „an Ort<br />
und Stelle“ zu bevorzugen. 179<br />
6.1.5 Terminaret, Z. 20<br />
Fraglich ist auch die Übersetzung <strong>des</strong> Worts „terminaret“ in Zeile 20, da das lateinische<br />
Verb terminare die unterschiedlichen Bedeutungen von „begrenzen“ bzw. „abgrenzen“,<br />
„bestimmen“, „entscheiden“ oder „beendigen“ haben kann. 180 So heißt es etwa in Roman<br />
176 Josef M. Stowasser et al. (Hrsg.), Stowasser, Lateinisch-deutsches Schulwörterbuch, Wien u.a.<br />
1998, 398, Stichwort „praesens“.<br />
177 Eric Herbert Warmington, Remains of old Latin, Band 4, Cambridge 1979, 262-271; CIL V 7749<br />
= CIL I 584 (p 739, 910).<br />
178 Vgl. Eric Herbert Warmington, Remains of old Latin, Band 4, Cambridge 1979, 262 f: “inquired<br />
on the spot”.<br />
179 Vgl. Umberto Laffi, Studi di storia romana e di diritto, Rom 2001, 184; Pascal Arnaud, Des<br />
documents méconnus du bornage: determinatio, depalatio, definitio, in: Antonio Gonzales/Jean-<br />
Yves Guillaumin (Hrsg.), Autour <strong>des</strong> Libri coloniarum, Colonisation et colonies dans le monde<br />
romain, Besançon 2006, 69 („sur le terrain“).<br />
180 Josef M. Stowasser et al. (Hrsg.), Stowasser, Lateinisch-deutsches Schulwörterbuch, Wien u.a.<br />
1998, 510, Stichwort „termino“; Herrmann Gottlieb Heumann, Heumanns Handlexikon zu den<br />
Rainer Lukits 56