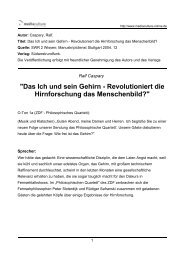Das Hörspiel. Dramaturgie und Geschichte - Mediaculture online
Das Hörspiel. Dramaturgie und Geschichte - Mediaculture online
Das Hörspiel. Dramaturgie und Geschichte - Mediaculture online
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
<strong>Hörspiel</strong>e Archibald MacLeish entwickelten, schon seltene Ausnahmeerscheinungen<br />
blieben. Dagegen gibt es volkstümliche, den Sketchen <strong>und</strong> Einaktern ähnliche Strukturen<br />
mit wenig Personen <strong>und</strong> ohne Problem oder mit handfester Modellproblematik, die zwar<br />
vielfach als <strong>Hörspiel</strong>e geschrieben wurden, für deren Realismus aber dann die Erfindung<br />
des Fernsehens geradezu eine Erlösung war.<br />
Anders, wo die Gesetzgebung jene notwendige Freiheit (auch vom Kommerziellen)<br />
bewirkte <strong>und</strong> wo Experimente möglich waren: überall da schlug die Entwicklung den Weg<br />
zum spezifischen R<strong>und</strong>funkwerk ein. <strong>Das</strong> geschah nicht nur in Deutschland, sondern<br />
auch in England, Italien, Frankreich, Skandinavien <strong>und</strong> außerhalb Europas vor allem in<br />
Japan. ∗<br />
In Rufer <strong>und</strong> Hörer hat Reinacher schon 1931 die außerordentlichen Möglichkeiten, die<br />
dem <strong>Hörspiel</strong> aus seiner Freiheit, z. B. gegenüber dem Theater, erwachsen,<br />
charakterisiert:<br />
»<strong>Das</strong> <strong>Hörspiel</strong> bietet mir die würdigeren Bedingungen des Schaffens. Wie ist das möglich?<br />
Darum, weil der R<strong>und</strong>funk in größeren Verhältnissen steht. Er bietet mehr Ausgleich der<br />
Spannungen, mehr Stetigkeit <strong>und</strong> dadurch mehr Überblick <strong>und</strong> mehr Freiheit. Der<br />
Theaterdirektor, der sich entschlossen hat, ein Stück zu bringen, muß diesem Stück vor den<br />
einigemal-h<strong>und</strong>ert Theaterbesuchern eines Abends zum Erfolg verhelfen, so daß sie<br />
mindestens fünf Minuten lang nach dem Fall des Vorhangs klatschen. Dabei gibt es kaum eine<br />
Norm der Beschaffenheit, aus der eine sichere Voraussetzung des Erfolgs zu entnehmen wäre.<br />
Die Interessen des Publikums sind zu wenig einheitlich dazu. Dagegen sind die R<strong>und</strong>funkhörer<br />
so gemischt, daß der Durchschnittsansatz der Berechnung stimmt, daß der R<strong>und</strong>funk mit den<br />
so<strong>und</strong>soviel Tausenden, die er für das Hören gewinnen will, leichteres Spiel hat als das Theater<br />
mit den H<strong>und</strong>erten, die für das Klatschen gewonnen werden müssen. <strong>Das</strong> <strong>Hörspiel</strong> ist, was es<br />
ist; es ist gesendet worden, wer es hören wollte, hörte, <strong>und</strong> wem es nicht zusagte, schaltete ab<br />
bis zur nächsten Darbietung, die ihn lockte. Wenn ein <strong>Hörspiel</strong> stofflich geeignet ist, so wird es<br />
unter der großen Zahl von Hörern so viel Fre<strong>und</strong>e finden, daß die Sendung sich gelohnt haben<br />
wird, auch wenn es vielen Hörern nicht zusagen konnte. So kann das <strong>Hörspiel</strong> wagen, was auf<br />
der Bühne <strong>und</strong>enkbar geworden ist. Es kann sich auf Landschaften der Seele einstellen, die aus<br />
der psychologischen Geographie der Bretter gestrichen sind. <strong>Das</strong> <strong>Hörspiel</strong> darf glauben, lieben,<br />
hoffen, es darf scherzen, singen, weinen, es darf aus vollem Herzen lachen, mit einem Wort: es<br />
darf sein, wo das Bühnenstück darauf angewiesen ist, im derbsten Sinne zu wirken. Und es darf<br />
trotz Sünden gegen die Bürger von rechts-rechts bis links-links dankbarer Hörer gewiß sein.«<br />
∗ Die Anhänger eines »kommerziellen«, das heißt durch Werbung zu finanzierenden R<strong>und</strong>funks <strong>und</strong><br />
Fernsehens, bezeichnen die R<strong>und</strong>funkfreiheit in den aktuellen politischen Auseinandersetzungen gern<br />
als »Monopolstellung der R<strong>und</strong>funkanstalten«. Aber die Anwendung dieses Begriffs aus der Wirtschaft<br />
auf einen geistigen Tatbestand, wo er das Gegenteil bedeuten müßte, wenn er nicht sinnlos sein soll –<br />
nämlich Freiheit vom Zugriff jeder Machtgruppe, die gern selbst das Monopol hätte – ist unverkennbar<br />
demagogisch. Die Frage ist: soll der Staat interessenabhängige Sendegesellschaften lizenzieren oder<br />
durch Gesetz unabhängige – im labilen Gleichgewicht zwischen den Kräften – konstituieren? Läßt sich<br />
ein Primat politischer oder wirtschaftlicher Aspekte vermeiden, wird die kulturelle Freiheit gewinnen.<br />
118