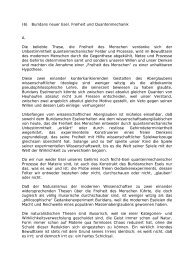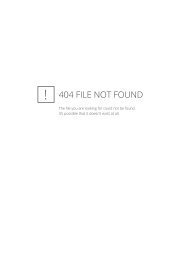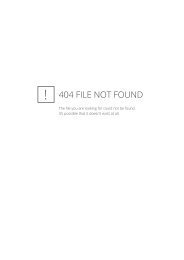Hegel: Vorlesungen über die Beweise vom Dasein ... - Leo-dorner.net
Hegel: Vorlesungen über die Beweise vom Dasein ... - Leo-dorner.net
Hegel: Vorlesungen über die Beweise vom Dasein ... - Leo-dorner.net
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Diese Aussagen erschrecken unser Erfahrungsbewusstsein und<br />
Verstandesdenken, weil man meint, am „<strong>Dasein</strong>“ und an der „Existenz“<br />
alles haben zu können und alles zu haben, was man begehrt - <strong>vom</strong> Inhalt<br />
der Sache und aller Sachen. Und ob aus dem Erschrecken ein Verstehen<br />
folgt, ist ungewiß, weil das sinnliche Ferment in aller Erfahrung und<br />
Verstandestätigkeit wie eine Fesselung wirkt, <strong>die</strong> <strong>vom</strong> Inhalt und dessen<br />
Erkenntnis zu abstrahieren zwingt.<br />
Dieser Einstellung macht <strong>Hegel</strong> den Vorwurf, daß es ihr gleichgültig sei,<br />
welchen Inhaltes Gottes Sein sei, wenn nur „<strong>über</strong>haupt“ gesichert und<br />
beweisbar sei, daß es sei.<br />
Die Gleichgültigkeit gegen<strong>über</strong> dem Inhalt ist eine - im Prinzip - zweifache<br />
und entgegengesetzte: in Zeiten starker und dominanter Religiosität wird<br />
der Inhalt durch <strong>die</strong> amtierende Religion vorgegeben und als bewiesen<br />
vorgesetzt, als Glaubensinhalt, der als gegeben und tra<strong>die</strong>rt genommen<br />
wird. Daß hier das Gottesbeweisen aus Vernunft nur ein Hinzukommendes<br />
ist, versteht sich; daher auch <strong>die</strong> Äußerlichkeit der Gottesbeweise im<br />
Mittelalter; <strong>die</strong>se riskierten wenig, weil <strong>die</strong> Vernunft nicht gegen <strong>die</strong><br />
Heiligkeit des Inhaltes und seiner kirchlichen Lehre und Gestalt agieren<br />
konnte und wollte.<br />
Anders liegen <strong>die</strong> Dinge, wenn Atheismus und Säkularität vorherrschen,<br />
wie etwa seit den Tagen der Aufklärung in der westlichen Welt. Wird hier<br />
<strong>vom</strong> Inhalt abstrahiert, dann wird das Gottesbeweisen geradezu ein<br />
Zauberakt, weil mit dem <strong>Dasein</strong> des Inhaltes zunächst nur ein<br />
unbestimmtes Wesen, <strong>die</strong> Wesenheit eines Gottes ausgesagt würde, dem<br />
jede konkrete inhaltliche Bestimmung fehlte; würde dennoch zu einem<br />
Inhalt aus dem (bewiesenen) <strong>Dasein</strong> fortgegangen, kann nur gezaubert<br />
werden, also: willkürlich behauptet werden, etwa: daß <strong>die</strong> Natur der Inhalt<br />
sei; oder das reine Denken der Vernunft; oder der Mensch; oder <strong>die</strong><br />
Menschheit; oder auch <strong>die</strong> Kunst und der Künstler.<br />
Auch der „sogenannte Begriff“ erregt <strong>Hegel</strong>s Sympathie nicht, obwohl sein<br />
Gang kein anderer ist als jener <strong>vom</strong> Begriff zu seinem <strong>Dasein</strong>; doch liegt<br />
der Mangel der „alten“ (Gottes)Begriffe eben darin, daß sie nicht an ihnen<br />
entwickelt, sondern wie Dogmen aufgestellt wurden, aus Axiomen, <strong>die</strong><br />
durch Autorität <strong>über</strong>nommen wurden. Indes der wahre Begriff ein sich<br />
begreifender sei, also ein sich begründender; und daher ist nur jener<br />
Begriff kein „sogenannter“, der <strong>die</strong>se Letzt- oder Erstbegründung mit sich<br />
führt: aus sich heraus setzt und in sich zurücksetzt.]<br />
Es ist daher <strong>die</strong>se Reflexion nicht ausdrücklich vorhanden, daß durch jene<br />
Übergänge des Schließens sich <strong>die</strong> Inhaltsbestimmungen ergeben; am<br />
wenigsten in dem <strong>Beweise</strong>, der insbesondere von dem vorher<br />
ausgemachten Begriffe Gottes ausgeht und ausdrücklich nur das Bedürfnis<br />
befriedigen soll, jenem Begriff <strong>die</strong> abstrakte Bestimmung des Seins<br />
hinzuzufügen. [160 Das Schließen in der „alten“ Metaphysik wurde als<br />
äußeres Werkzeug betrachtet, das an eine für sich schon fertige Sache<br />
herangebracht wurde. Nun darf man daraus nicht „schließen“, daß <strong>Hegel</strong>s<br />
Ansatz ein „konstruktivistischer“ sei; etwa dergestalt, daß durch unser<br />
Schließen <strong>die</strong> Konstruktion eines Gottesbegriffes oder eines<br />
148