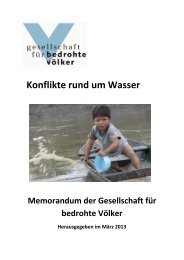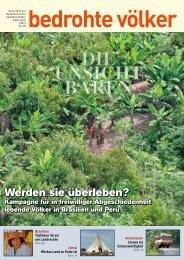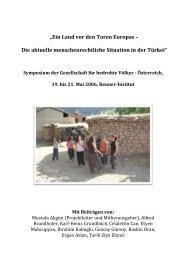Moderne Autonomiesysteme - Gesellschaft für bedrohte Völker
Moderne Autonomiesysteme - Gesellschaft für bedrohte Völker
Moderne Autonomiesysteme - Gesellschaft für bedrohte Völker
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Macht reguliert werden Wenn sowohl die staatliche<br />
Souveränität und Einheit als auch die kollektiven<br />
Rechte und die Selbstregierung von Minderheiten<br />
gewahrt werden soll, ist eine vertikale Gewaltenteilung<br />
zwischen verschiedenen Regierungsebenen von<br />
entscheidender Bedeutung. Dieser Prozess ist bisher -<br />
in historischer Perspektive betrachtet - vor allem in der<br />
Anwendung föderalistischer Staatsordnungen und der<br />
Dezentralisierung von Einheitsstaaten erfolgt, doch nur<br />
in Ausnahmefällen in Form territorialer Autonomie oder<br />
anderer ad-hoc-Regelungen staatlicher Strukturen.<br />
Dabei geht territoriale Gewaltenteilung nicht nur auf<br />
die Herausforderung ethnischer Konflikte ein, sondern<br />
zielt auf ein Grundanliegen der Demokratie ab: wenn<br />
bestimmte Regionen Autonomie erhalten, erhalten<br />
lokale oder regionale Gemeinschaften die Möglichkeit,<br />
ihre Probleme vor Ort selbst zu lösen. Man eröffnet<br />
damit die Chance, Demokratie zu vertiefen, indem<br />
die politischen Vertretungsrechte verbessert und<br />
Partizipationschancen über die Ebene der zentralen<br />
Staatsverwaltung hinaus ausgeweitet werden. Dies<br />
ist ein Grundbedürfnis und Grundrecht nationaler<br />
Minderheiten. 6 Kurz gesagt: das urdemokratische<br />
Grundbedürfnis nach Selbstregierung im Rahmen einer<br />
gewachsenen Gemeinschaft wird von jenen Gruppen<br />
stärker empfunden, die sich von der Titularnation<br />
eines Staates in ethnischer, religiöser, sprachlicher<br />
Hinsicht unterscheiden.<br />
Wie können ethnische Konflikte nachhaltig gelöst<br />
werden? Die Schule der „Realisten“ geht davon aus,<br />
dass territoriale Gliederung und institutionelle vertikale<br />
Gewaltenteilung optimale Chancen zur langfristigen<br />
Lösung bilden. Auf der anderen Seite spricht sich<br />
eine andere Denkrichtung, jene der „Idealisten“, <strong>für</strong><br />
den Aufbau multinationaler <strong>Gesellschaft</strong>en auf der<br />
Grundlage von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und<br />
dem Schutz individueller Minderheitenrechte aus.<br />
Gemeinsam ist beiden Denkschulen die wachsende<br />
Einsicht in die Notwendigkeit von individuellen und<br />
kollektiven Minderheitenrechten, die in zahlreichen<br />
internationalen Rechtsinstrumenten verankert sind.<br />
Doch schon bei der Anwendung dieser Rechte nimmt<br />
6 Capotortis weithin akzeptierte Definition einer nationalen Minderheit<br />
lautet: “Minderheiten sind im Vergleich mit der Mehrheitsbevölkerung<br />
eines Staates zahlenmäßig kleinere Gruppen, die sich in<br />
einer nicht dominanten Position befinden, deren Mitglieder, Bürger<br />
desselben Staates sind und andere ethnische, religiöse oder sprachliche<br />
Merkmale haben als die restliche Bevölkerung und zumindest<br />
implizit ein Gefühl der Solidarität entwickelt haben, um ihre Kultur,<br />
Tradition, Religion oder Sprache zu erhalten.” (zitiert aus: Christoph<br />
Pan/Beate S. Pfeil, Minority Rights in Europe: A Handbook of<br />
European National Minorities, Vol.2, Wien 2002)<br />
2 Das Konzept der politischen Autonomie<br />
die Übereinstimmung stark ab.<br />
Zwei alternative Lösungen sind bisher auch auf die<br />
Notwendigkeit der territorialen Untergliederung<br />
von Staaten zwecks gerechterer Verteilung der<br />
Macht geboten worden: zum einen der klassische<br />
symmetrische Föderalismus mit wenigen Ausnahmen<br />
der „asymmetrischen Spielart“ von Bundesstaaten.<br />
Zum andern politische Autonomie in verschiedenen<br />
Formen. Bundesstaaten sind in der Regel<br />
„symmetrisch“ aufgebaut, wenn allen konstituierenden<br />
Territorialeinheiten des Staates dieselben Befugnisse<br />
erhalten. In symmetrischen Bundesstaaten ist ein<br />
oder mehrere Gliedstaaten zudem mit besonderen<br />
Befugnissen ausgestattet, die den anderen<br />
Gliedstaaten vorbehalten bleiben, insbesondere<br />
um eine besondere Kultur, Sprache und Lebensform<br />
zu schützen. Wie die Beispiele Kanada, Indien und<br />
Russland zeigen, ergibt sich daraus ein fließender<br />
Übergang von asymmetrischen Föderalstaatsformen zu<br />
Staaten mit ein oder mehreren Territorialautonomien.<br />
Obwohl asymmetrische Föderalstaaten grundsätzlich<br />
auf einer föderalen Verfassung beruhen, umfassen<br />
sie einige Territorialeinheiten mit ganz besonderen<br />
Befugnissen. 7 Diese Form staatlicher Organisation<br />
könnte auch als „besondere Territorialautonomie im<br />
Rahmen eines Bundesstaats“ bezeichnet werden<br />
können. Es gibt demnach verschiedene Formen<br />
territorialer Gewaltenteilung, die sich oft nicht<br />
ausschließen, sondern je nach politischem Kontext<br />
flexibel kombiniert werden können.<br />
Föderalismus ist die bekannteste Form der territorialen<br />
Aufteilung von staatlichen Regulierungsbefugnissen.<br />
Seine Grundidee geht von der Gleichberechtigung<br />
aller beteiligten Regionen oder Gliedstaaten aus,<br />
die im selben Rechtsverhältnis zum Zentralstaat<br />
stehen. Verschiedene Beispiele aus der Geschichte<br />
und der heutigen politischen Realität beweisen, dass<br />
man dadurch im Staatsaufbau ethnischer Vielfalt am<br />
besten gerecht geworden ist, wie etwa in der Schweiz,<br />
Indien und Russland. Föderalismus wurde auch zur<br />
Lösung ethnischer Konflikte eingeführt, nachdem sich<br />
zentralistische Strukturen wie in Belgien, Malaysia<br />
und Nigeria als untauglich erwiesen hatten. Doch<br />
wenn nur eine oder wenige nationale Minderheiten,<br />
die auf einem kleineren Teil des Staatsgebiets siedeln,<br />
eine besondere vertikale Gewaltenteilung erfordern,<br />
scheint ein Föderalsystem nicht nötig. In einigen<br />
7 Dies trifft auf Nunavut im föderalen Kanada, auf Tatarstan<br />
und viele andere Föderationssubjekte in Russland, auf einige<br />
Staaten des indischen Nordostens sowie Jammu und Kaschmir<br />
und auf die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens zu.<br />
Die Unterscheidungskriterien werden in Kapitel 2.2 erläutert.<br />
15