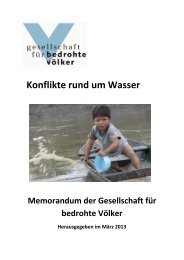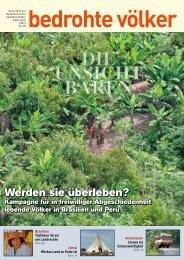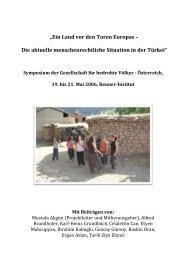Moderne Autonomiesysteme - Gesellschaft für bedrohte Völker
Moderne Autonomiesysteme - Gesellschaft für bedrohte Völker
Moderne Autonomiesysteme - Gesellschaft für bedrohte Völker
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
4 Besondere Formen von Autonomie<br />
indigenen <strong>Völker</strong> teils durch die nationalen Parteien<br />
organisiert, teils haben die Indigenen ihre eigenen<br />
Parteien. Die Herausforderung <strong>für</strong> „ethnische<br />
Parteien“ besteht immer darin, über die Formulierung<br />
von Forderungen und Lösungsvorschlägen <strong>für</strong> die<br />
Probleme der indigenen <strong>Völker</strong> hinauszugehen und<br />
eigene Vorschläge <strong>für</strong> die übergreifenden nationalen<br />
Probleme vorzulegen.<br />
Welche formalen Aspekte haben die <strong>Autonomiesysteme</strong><br />
in diesen vier Ländern? In Panama und in Kolumbien wird<br />
innerhalb der autonomen Strukturen ein direktdemokratisches<br />
und konkordanz-demokratisches Modell der<br />
Territorial-autonomie angewandt. In Nicaragua geraten<br />
die politischen Kräfte und Organisationen der Indigenen<br />
und die Institutionen der autonomen Regionen im<br />
Kontext einer pluriethnischen Bevölkerung auch immer<br />
wieder in Konflikt. In Ecuador wiederum existieren<br />
öffentlich-rechtliche kommunale Institutionen neben<br />
den Einrichtungen indianischer Selbstverwaltung.<br />
In einigen Ländern wie etwa in Guatemala sind neben<br />
den Kommunen (alcaldías) besondere indigene<br />
Gebietskörperschaften (municipios indígenas)<br />
eingerichtet worden. In einigen ländlichen Gebieten<br />
mit einer indigenen Mehrheitsbevölkerung wählen die<br />
Dörfer (cantones) ihren eigenen Bürgermeister mit<br />
einem besonderen Wahlrecht.<br />
Doch haben diese eine ziemlich begrenzte Autonomie<br />
und sind insbesondere bezüglich der Finanzen<br />
den alcaldías untergeordnet. Die indigenen <strong>Völker</strong><br />
Guatemalas versuchen, über comités civicos (freie<br />
politische Listen) auch aktiv die Politik mitzugestalten.<br />
In Bolivien sind keine speziellen Territorien <strong>für</strong> die<br />
Indigenen eingerichtet worden, doch ist eine allgemeine<br />
Dezentralisierung der staatlichen Strukturen im<br />
Gange. Die dezentralen Gebietseinheiten (Kommunen,<br />
Provinzen) sind ermächtigt, auch indigene Fragen in<br />
autonomer Weise zu regeln, doch bleiben sie immer<br />
organischer Teil der öffentlichen Lokalverwaltung. 327<br />
327 Willem Assies (2005), S.202<br />
4.3.5 Die “caracoles” in Chiapas:<br />
eine de facto-Autonomie?<br />
Am 1. Januar 1994 besetzte die Zapatistische<br />
Befreiungsarmee (Ejercito Zapatista de Liberación<br />
Nacional, EZLN) einen kleinen Teil des mexikanischen<br />
Bundesstaats Chiapas, der überwiegend von indigenen<br />
<strong>Völker</strong>n bewohnt wird. Sie forderte kulturelle Autonomie,<br />
Landrechte, demokratische Mitbestimmung und<br />
lehnte die neoliberalen Wirtschaftsstrategien der<br />
mexikanischen Regierung ab. Am selben Tag war<br />
offiziell Mexikos Beitritt zur nordamerikanischen<br />
Freihandelszone (NAFTA) in Kraft getreten. Die<br />
Zapatistenbewegung war ein leuchtendes Signal des<br />
Aufbruchs <strong>für</strong> Volksbewegungen <strong>für</strong> die Rechte der<br />
Indianer, der armen Bauern und Landarbeiter nicht nur<br />
in Mexiko, sondern in vielen Regionen Lateinamerikas.<br />
Die mexikanische Regierung versuchte, diese militante<br />
Bewegung mit allen Mitteln zu unterdrücken, auch<br />
mit militärischer Repression. Im August 2003 taten<br />
sich fünf von Zapatisten kontrollierte Regionen in<br />
Chiapas mit etwa hundert Gemeinden mit von rund<br />
300.000 Einwohnern zusammen, um eine inoffizielle<br />
„autonome Zapatistenregion“ zu bilden. Die EZLN,<br />
die seit 1994 keine neuen militärischen Aktionen<br />
mehr durchgeführt hat, betrachtete diesen Schritt als<br />
logische Fortsetzung des Abkommens von 1996 zur<br />
kulturellen Autonomie und den Rechten der Indianer,<br />
das in der Ortschaft San Andrés in Chiapas mit der<br />
mexikanischen Regierung abgeschlossen worden war.<br />
Die zumeist sehr armen und wirtschaftlich rückständigen<br />
Gemeinden erklärten ihre Autonomie und verwalten<br />
sich seitdem mit demokratischen Verfahren selbst. Die<br />
fünf Regionen unter zapatistischer Kontrolle werden<br />
in Chiapas auch caracoles (Schnecken) genannt. Die<br />
autonomen Gemeinschaften versuchen seitdem,<br />
ein eigenständiges Gesundheitswesen, Schulwesen,<br />
Handelsnetz und genossenschaftlich organisierte<br />
Produktionstätigkeit auf den Weg zu bringen. Doch das<br />
211