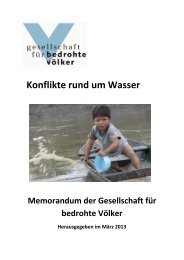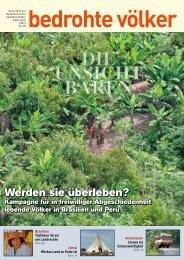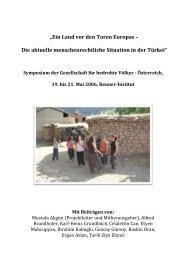Moderne Autonomiesysteme - Gesellschaft für bedrohte Völker
Moderne Autonomiesysteme - Gesellschaft für bedrohte Völker
Moderne Autonomiesysteme - Gesellschaft für bedrohte Völker
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
208<br />
<strong>Moderne</strong> <strong>Autonomiesysteme</strong><br />
Reservate in Australien?<br />
In Australien wurden 1994 303.261 Ureinwohner<br />
(Aborigines und Torres Strait Islanders) gezählt (1,5%<br />
der Gesamtbevölkerung Australiens), wovon 66%<br />
in Städten leben. Im Unterschied zu den Aborigines<br />
bilden die rund 10.000 Torres Strait Islanders eine<br />
homogene ethnische Gemeinschaft, die eine Gruppe<br />
von 20 Inseln in der Torres Strait Meerenge bewohnt.<br />
Sie leben primär vom Fischfang. 1989 wurde gemäß<br />
des „Aboriginal and Torres Strait Islands Commission<br />
Act“ (ATSCA) die Aboriginal and Torres Strait Islanders<br />
Commission (ATSIC) ins Leben gerufen, um die<br />
Mitwirkung beider Gruppen an der Formulierung und<br />
Umsetzung von Regierungsmaßnahmen zur Stärkung<br />
der Selbstverwaltung, der Eigenständigkeit und zur<br />
kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen Entwicklung zu<br />
regeln. Dabei wurde keine getrennte Kommission <strong>für</strong><br />
die Torres Strait Islanders eingerichtet. Mit diesem<br />
Gesetz hat Australien seine indigene Bevölkerung als<br />
ein getrenntes, kollektives Rechtsobjekt anerkannt,<br />
das ein Recht auf Selbstverwaltung hat. Obwohl die<br />
erstmals 1996 zusammengetretene ATSIC aus 17<br />
Kommissaren besteht, werden beide Vorsitzenden<br />
von der Bundesregierung gewählt. Deshalb erfüllt<br />
die ATSIC eher die Aufgabe eines beratenden Organs<br />
denn eines Selbstverwaltungsorgans. Die Torres Strait<br />
Islanders sind weder im Parlament von Queensland<br />
noch im Bundesparlament vertreten. Obwohl der<br />
gewählte Regionalrat von Torres Strait einige begrenzte<br />
Kompetenzen hat (keine Gesetzgebung), gibt es<br />
dabei kein Konzept <strong>für</strong> ein Reservat nach US-Muster,<br />
geschweige denn <strong>für</strong> Territorial-autonomie, die jetzt<br />
aber gefordert wird. 317<br />
4.3.4 Reservate in<br />
Lateinamerika<br />
Lateinamerikas indigene <strong>Völker</strong> und<br />
Territorialautonomie<br />
Inmitten der Vielfalt an Auffassungen und Definitionen<br />
von Autonomie in der Welt der indigenen <strong>Völker</strong><br />
Lateinamerikas sind zwei Grundansätze zu<br />
beobachten: der erste wird ziemlich treffsicher von<br />
Gonzales umschrieben, einem indianischen Mitglied<br />
des Parlaments von Venezuela: 318<br />
317 Weitere Informationen dazu in: Int. Committee of Lawyers for<br />
Tibet, op- cit., 1999, S. 578-600<br />
318 Zitiert nach Heidi Feldt, Indigene <strong>Völker</strong> und Staat, in: GTZ-<br />
Reader Indigene <strong>Völker</strong> in Lateinamerika und Entwicklungszusammenarbeit,<br />
2004, S. 52 unter: http://www2.gtz.de/indigenas/deutsch/<br />
“Die Autonomie indigener <strong>Völker</strong> muss als das Recht<br />
jener <strong>Völker</strong> betrachtet werden, frei über ihre inneren<br />
Angelegenheiten zu entscheiden, über ihre soziale,<br />
wirtschaftliche, politische und kulturelle Organisation<br />
und über die Führung, Kontrolle und den Besitz<br />
ihres Landes. Eine wesentliche Bedingung <strong>für</strong> die<br />
Verwirklichung dieses Konzepts ist die Anerkennung<br />
dieser <strong>Völker</strong> in der Verfassung ihrer Staaten, ohne<br />
dass die Einheit und Unteilbarkeit dieser Republiken<br />
in Frage gestellt würde. Ausgehend von diesen<br />
Voraussetzungen kann das Konzept der Autonomie<br />
innerhalb von Nationalstaaten angewandt werden“.<br />
Somit wird indigene Autonomie durch die Festlegung<br />
eines klar abgegrenzten Territoriums, durch die<br />
Anerkennung eines indigenen Volkes und seines Rechtes<br />
auf interne Selbstbestimmung in diesem Rahmen<br />
konkretisiert, wobei allgemeine Staatsfunktionen wie<br />
Verteidigungs- und Außenpolitik nicht berührt werden.<br />
Die Grundvoraussetzung liegt in einem abgrenzbaren<br />
Gebiet, das ausschließlich oder überwiegend von<br />
einem indigenen Volk bewohnt wird. Dieses Konzept<br />
scheint in einigen mittelamerikanischen Ländern, im<br />
Amazonas-Tiefland und im Chaco anwendbar zu sein,<br />
nicht jedoch in weiten Teilen der Anden, wo es bisher<br />
auch kaum indianische Reservate gibt. 319<br />
Roldan hingegen erweitert das Konzept der Autonomie<br />
zur Idee der Selbstverwaltung im Rahmen der<br />
bestehenden Territorialeinheiten wie Kommunen,<br />
Provinzen, Regionen innerhalb der Grenzen der<br />
bestehenden Staaten, wobei über Rechtsnormen<br />
und Selbstverwaltung die internen Interessen<br />
des indigenen Volks und der lokalen Bevölkerung<br />
wahrgenommen werden können. 320 Dies sollte <strong>für</strong><br />
ein Volk die Möglichkeit implizieren, unabhängig und<br />
selbstbestimmt zu leben, ohne auf die internationale<br />
Politik eines Staates Einfluss nehmen zu müssen.<br />
service/reader.html ; zu den Rechtsgrundlagen von Reservationen<br />
vgl. Natalia Loukacheva, Autonomy and Law, Toronto 2006, zu<br />
finden auf: http://www.globalautonomy.ca/global1/article.<br />
jsp?index=RA_Loukacheva_AutonomyLaw.xml<br />
319 Neben den legal errichteten und anerkannten autonomen Regionen<br />
gibt es auch “ganz autonom” ins Leben gerufene <strong>Autonomiesysteme</strong><br />
wie z.B. jene der zapatistischen Gemeinschaften in Mexiko<br />
(die Regiones Autonomas Plurietnicas in Chiapas, vgl. http://www.<br />
ezln.org and http://www.ezlnaldf.org and http://www.utexas.edu<br />
und Gonzalez, Miguel, Territorial Autonomy in Mesoamerica: With<br />
or Without State Consent. The case of the Zapatista Autonomous<br />
Territories in Chiapas, Mexico, and of the Autonomous Regions in<br />
Nicaragua”, paper for the Workshop on Social Movements & Globalisation:<br />
resistance or Engagement, University Consortium on the<br />
Global South, Toronto York University 2004. Vgl. Auch weiter unten<br />
die Box “Die caracoles in Chiapas”.<br />
320 Zitiert von Heidi Feldt (2004), S.53