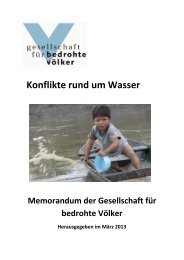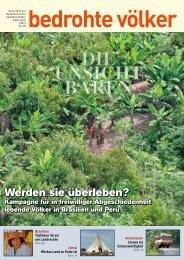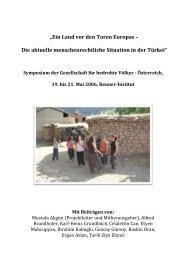Moderne Autonomiesysteme - Gesellschaft für bedrohte Völker
Moderne Autonomiesysteme - Gesellschaft für bedrohte Völker
Moderne Autonomiesysteme - Gesellschaft für bedrohte Völker
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>für</strong> die Anerkennung von ethnischen und nationalen<br />
Minderheiten und <strong>für</strong> die Förderung ihrer kollektiven<br />
Identität. Andererseits konnten diese allgemeinen<br />
Rechtsnormen auf staatlicher und regionaler Ebene<br />
ein bestimmtes Bedürfnis nationaler Minderheit nicht<br />
erfüllen: sich im eigenen Siedlungsgebiet selbst zu<br />
regieren.<br />
Es kann nicht geleugnet werden, dass die Frage der<br />
Identität ethnischer Gruppen eng verknüpft ist jenem<br />
Territorium, das seit Urzeiten von diesen als einer<br />
homogenen Gruppe bewohnt worden ist. Ohne den<br />
Aspekt der Kulturautonomie (oder Personenautonomie)<br />
zu berühren, kann der Schutz einer Minderheit am besten<br />
in einem abgegrenzten geographisch-kulturellen Raum<br />
erfolgen. Im Unterschied zu den „neuen Minderheiten“<br />
der Migranten, die verstreut über das Gastland leben,<br />
ist der Schutz von autochthonen Minderheiten eng<br />
geknüpft an die geographische Region, die von einer<br />
Gruppe mit einer verschiedenen kulturellen Identität<br />
bewohnt wird. Im Zuge der Geschichte wurde diese<br />
Region Teil eines Staates mit einer anderen ethnischen<br />
(oder auch religiösen) Mehrheit, woraus überhaupt erst<br />
die Notwendigkeit territorialer Autonomie erwuchs.<br />
Doch keine internationale Konvention erkennt<br />
ethnischen oder nationalen Minderheiten ein solches<br />
„Recht auf Autonomie“ oder ein „Recht auf interne<br />
Selbstbestimmung“ zu. Verschiedene Anläufe, eine<br />
Charta der Rechte indigener <strong>Völker</strong> innerhalb der VN zu<br />
verabschieden, scheiterten an der Ablehnung einiger<br />
Staaten. Im Gegenteil: viele Staaten betrachten<br />
politische Autonomie als ersten Schritt in Richtung<br />
externe Selbstbestimmung mit nachfolgender<br />
Sezession. Historische Erfahrungen in Europa haben<br />
bewiesen, dass Autonomie als Instrument der<br />
Konfliktlösung taugt und Sezession eher verhindert.<br />
Mit anderen Worten: nicht die Gewährung, sondern<br />
die Vorenthaltung von Autonomie hat die kritische<br />
Eskalation von Minderheitenkonflikten mit zahlreichen<br />
bewaffneten Widerstand (Baskenland, Nordirland,<br />
Chittagong Hill Tracts, Bougainville, Aceh, Südsudan,<br />
Atlantikregion Nicaraguas, Korsika, Neukaledonien,<br />
Mindanao, Jammu und Kaschmir) im vergangenen<br />
Jahrhundert heraufbeschworen und Forderungen nach<br />
Unabhängigkeit geschürt (Albaner in Kosovo, Russen in<br />
Transnistrien, Abchasen und Südosseten in Georgien,<br />
Türken auf Zypern, Moros auf Mindanao, Kaschmiri<br />
in Kaschmir usw.). In Ermangelung eines solchen<br />
Rechts auf Autonomie oder einer „Pflicht der Staaten,<br />
nationalen Minderheiten Autonomie zu gewähren“,<br />
auf welche Rechtsgrundlagen kann sich die Forderung<br />
nach Autonomie stützen?<br />
2 Das Konzept der politischen Autonomie<br />
2.4.2 Rechtsgrundlagen <strong>für</strong> Autonomie<br />
im <strong>Völker</strong>recht<br />
Aus der historischen Entwicklung der heutigen<br />
Territorialautonomie treten bestimmte Formen der<br />
Legitimation <strong>für</strong> die Errichtung von <strong>Autonomiesysteme</strong>n<br />
klar hervor. 58 Rechtsnormen sind zunächst <strong>für</strong> die<br />
Begründung und Durchführung einer Autonomielösung<br />
von Bedeutung, später auch als legaler<br />
Schutzmechanismus, der aufgrund nationalem oder<br />
internationalem Recht den betroffenen Minderheiten<br />
zur Anwendung einer vereinbarten Autonomie verhilft.<br />
Die verfassungsrechtlich gebotene Möglichkeit,<br />
Autonomie zu gewähren oder sie zu beschränken, kann<br />
bei den Verhandlungen eine wesentliche Rolle spielen<br />
und die Verhandlungsposition der nationalen Minderheit<br />
stärken, vor allem wenn eine Vermittlung durch<br />
Drittmächte gewährleistet ist. In relativ wenigen Fällen<br />
ist Autonomie aufgrund eines bilateralen Abkommens<br />
zwischen Staaten (z.B. die Autonomie Südtirols durch<br />
den 1946 unterzeichneten Pariser Vertrag) oder durch<br />
die Entscheidung einer internationalen Organisation<br />
zustande gekommen (Eritreas Autonomie durch<br />
die VN 1952, die <strong>Völker</strong>bund-Entscheidung <strong>für</strong> die<br />
Autonomie der Åland-Inseln 1920). Üblicherweise<br />
wird bei Autonomie-forderungen auf drei wichtige<br />
Quellen des <strong>Völker</strong>rechts Bezug genommen: die<br />
Minderheitenrechte, die Rechte indigener <strong>Völker</strong> und<br />
– in eher kontroverser Form – das Recht der <strong>Völker</strong> auf<br />
Selbstbestimmung. 59<br />
a) Minderheitenrechte 60<br />
Seit ihrer Gründung haben sich die Vereinten<br />
Nationen (VN) in der Entwicklung eines umfassenden<br />
Menschenrechtssystems auf die Betonung der<br />
individuellen Rechte verlegt und es meist sorgfältig<br />
vermieden, kollektive Rechte Gruppen zuzuerkennen,<br />
vor allem keine politischen Rechte. Artikel 27 der<br />
58 Ein kurzer, aber höchst scharfsinniger Essay zu diesem Thema<br />
stammt von Natalia Loukacheva (Toronto 2006), Autonomy and Law,<br />
http://www.globalautonomy.ca/global1/article.jsp?index=RA_Loukacheva_AutonomyLaw.xml<br />
59 Eine umfassende Reflexion zu diesem Thema stammt von Joseph<br />
Marko, Autonomie und Integration, Rechtsinstitute des Nationalitätenrechts<br />
im funktionalen Vergleich, Böhlau Wien 1995;<br />
insbesondere: Autonomie: zur faktischen Existenz von Gruppen als<br />
Voraussetzung individueller Grundrechtsgewährleistung, S. 262-<br />
296; außerdem bemerkenswert die „Allg. Erklärung der kollektiven<br />
<strong>Völker</strong>rechte“ in: www.ciemen.org/pdf/ang.PDF:<br />
60 Die umfassendste aktuelle Darstellung zu diesem Bereich<br />
findet sich in: Christoph Pan/Beate S. Pfeil, Minderheitenrechte<br />
in Europa, Handbuch der europäischen Volksgruppen, Band 2,<br />
2. überarbeitete Auflage, Springer-Verlag Wien New York, 2006<br />
35