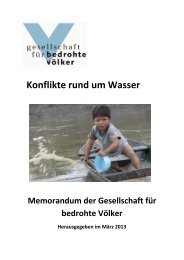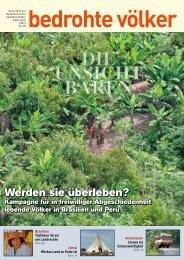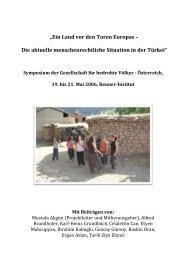Moderne Autonomiesysteme - Gesellschaft für bedrohte Völker
Moderne Autonomiesysteme - Gesellschaft für bedrohte Völker
Moderne Autonomiesysteme - Gesellschaft für bedrohte Völker
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
242<br />
<strong>Moderne</strong> <strong>Autonomiesysteme</strong><br />
einer vorgeblichen „historischen Ausdehnung“ eine<br />
nationale Minderheit oder ein Minderheitenvolk<br />
wiederum in eine Minderheitensituation in der eigenen<br />
autonomen Einheit zurückdrängen. 368 Es stellt sich<br />
somit das Risiko, dass eine Territorialautonomie seine<br />
Grundziele des Minderheitenschutzes nicht erreicht,<br />
wenn die angepeilte Minderheit zahlenmäßig auch in<br />
der autonomen Region eine Minderheit bleibt.<br />
Das Konzept der Territorialautonomie ist ein flexibles<br />
Instrument zur Aufteilung von Befugnissen, doch<br />
wenn Minderheitenschutz das Oberziel ist, müssen<br />
unabhängig von der Größe der Minderheiten<br />
beide Faktoren die zentrale Rolle der Minderheit<br />
unterstützen: die Ziehung der Grenzen der betroffenen<br />
Region und die internen Formen der gemeinsamen<br />
konkordanzdemokratischen Machtausübung. 369<br />
Dieses Argument führt zu einer eminent wichtigen<br />
Frage, die den Erfolg von Territorialautonomie<br />
als Mittel der Konfliktlösung ganz wesentlich<br />
mitbestimmt: neben dem Willen einer ethnischkulturellen<br />
Gruppe, als solche weiter zu bestehen,<br />
ist im Rahmen eines pluralistischen Autonomiesystems<br />
auch der Wille zum Zusammenleben und<br />
zur Zusammenarbeit erforderlich. Wenn ethnische<br />
Gruppen aus geschichtlichen Gründen und infolge lang<br />
anhaltender Gewalt in offenem Konflikt gegeneinander<br />
stehen, kann das Machtteilungsarrangement und<br />
die gemeinsame Verantwortung kaum zum Tragen<br />
kommen. In einigen der heutigen Territorialautonomien<br />
haben die nationalen Minderheiten seit Einrichtung<br />
der Autonomie innerhalb der Region die Mehrheit<br />
gegenüber den Angehörigen der nationalen Mehrheit<br />
gehabt. Der fehlende Wille zur Kooperation und<br />
Achtung der Rechte interner Minderheiten hat in<br />
Einzelfällen sogar zu „ethnischer Säuberung“ geführt,<br />
dem Versuch, gewaltsam ethnisch-homogene<br />
Regionen herzustellen. Dies setzte den Bestand und<br />
die Chance auf Autonomie aufs Spiel, sowohl durch<br />
Eingreifen des Zentralstaats als auch durch den Entfall<br />
der Unterstützung von außen, der Schutzmacht oder<br />
der internationalen Gemeinschaft. Um das kreative<br />
368 Dies ist in den Atlantikregionen Nicaraguas der Fall, insbesondere<br />
in der RAAN, wo indigene <strong>Völker</strong> sich immer mehr unter<br />
Druck fühlen. Auch in verschiedenen autonomen Regionen und<br />
Republiken Russlands ist diese Konfliktlage aktuell, wo „Titular-<br />
Minderheitenvölker“ gegenüber der russischen Bevölkerung in der<br />
Minderheit sind.<br />
369 Dies wäre der Fall, wenn die Autonome Gemeinschaft des<br />
Baskenlands auch die Autonome Gemeinschaft von Navarra umfassen<br />
würde, in welcher eine nur kleine Minderheit von Baskisch-<br />
Sprechern lebt. Die Baskisch sprechenden und „fühlenden“ Personen<br />
wären in einem solchen „größeren Baskenland“ in der zahlenmäßigen<br />
Minderheit<br />
Potenzial einer Autonomie zu entfalten, müssen in<br />
solchen Fällen konkordanzdemokratische Mechanismen<br />
und eine gemeinsame politische Verantwor-tung die<br />
territoriale Dimension der Autonomie stärken, indem<br />
jede Art von Vergeltung oder innerer Diskriminierung<br />
vermieden wird.<br />
Somit darf die territoriale Dimension einer Autonomie<br />
nie unterschätzt werden, wenn eine dauerhafte<br />
Konfliktlösung und Frieden erreicht werden sollen.<br />
Wenn eine Autonomie Erfolg haben soll, müssen die<br />
einzelnen Volksgruppen einer multiethnischen Region<br />
diese Region als gemeinsames Haus begreifen,<br />
worin politische Macht und Verantwortung auf alle<br />
verteilt werden muss, zum Nutzen aller. Dies fällt<br />
dort besonders schwer, wo die demographische<br />
Zusammensetzung einer Region politisch verändert<br />
worden ist, indem zahlreiche Angehörige des<br />
Mehrheitsvolks des Staats neu angesiedelt wurden<br />
(Chittagong Berggebiete, Südtirol, Krim, Irian Jaya)<br />
oder bei starker Präsenz von Nachfahren einstiger<br />
Siedler der früheren Kolonialmächte (Caldoches in<br />
Neukaledonien, Mestizos in Nicaraguas Atlantikregion,<br />
christliche Filipinos im muslimischen Mindanao, Javaner<br />
auf Irian Jaya). Eine Atmosphäre der Vergeltung und<br />
umgekehrter Diskriminierung verschafft dem Staat<br />
nichts anderes als einen Vorwand, zu intervenieren<br />
und die Autonomie wieder zu beschränken.<br />
Der Faktor Zeit ist ebenfalls von Bedeutung: die<br />
meisten erfolgreichen Autonomie-systeme brauchten<br />
Jahrzehnte bis zur vollen Umsetzung (z.B. Südtirol,<br />
Åland Inseln, Grönland, Färöer, Puerto Rico, Comarca<br />
Kuna Yala). Ihre Autonomiestatute erfuhren wiederholt<br />
eine weitgehende Revision, die den Grad an Autonomie<br />
insgesamt erhöhte. Autonomieprozesse in Ostasien<br />
zeigen, dass die Abtretung eines Teils der Staatsgewalt<br />
an substaatliche Einheiten in Staaten wie Papua Neu<br />
Guinea, Indonesien, den Philippinen aber auch in<br />
Frankreich lange Zeit und Geduld der betroffenen<br />
Regionen erforderte. Der vielleicht schmerzlichste<br />
Werdegang einer Autonomielösung war jener des<br />
Südsudan mit 19 Jahren Krieg und politischem Konflikt<br />
und mehr als zwei Millionen Opfern. Im Nachhinein lässt<br />
sich erkennen, dass der sudanesische Staat, so wie er<br />
aus der Kolonialzeit heraus 1954 gegründet worden<br />
war, sich nie <strong>für</strong> ein stabiles Autonomiesystem <strong>für</strong> den<br />
Süden engagiert hat. Überdies ist die Bevölkerung<br />
des südlichen Teils des nach Fläche größten Staats<br />
Afrikas nie in demokratischer Form um Zustimmung<br />
zur „Zwangsehe“ mit dem Norden befragt worden.<br />
Stabilität scheint ein weiteres wichtiges Element zu