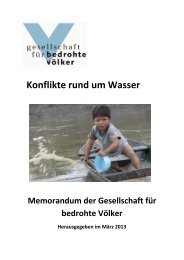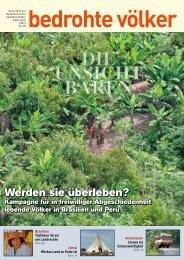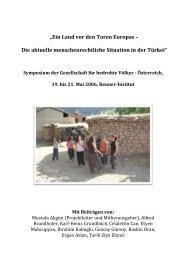Moderne Autonomiesysteme - Gesellschaft für bedrohte Völker
Moderne Autonomiesysteme - Gesellschaft für bedrohte Völker
Moderne Autonomiesysteme - Gesellschaft für bedrohte Völker
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
3 Territorialautonomie am Werk<br />
ethnische Exklusivität erfolgen muss. 228<br />
In Lateinamerika sind nicht nur in Panama (Comarca<br />
Kuna Yala) und in Nicaragua (Atlantikregionen)<br />
Territorialautonomien in diesem Sinne eingerichtet<br />
worden, sondern auch in Kolumbien. Doch aufgrund<br />
der mangelnden Durchführungsbestimmungen und<br />
praktischen Umsetzung sind die autonomen Gebiete<br />
Kolumbiens kaum funktionsfähig und können nicht mit<br />
den Territorialautonomien Nicaraguas und Panamas<br />
auf dieselbe Ebene gestellt werden.<br />
3.14.1 Die Entstehung der Autonomie<br />
Während der Zeit der Kolonisierung vermochten die<br />
Kuna-Gemeinschaften relativ unbehelligt zu leben, ohne<br />
durch die koloniale Machtstruktur in die mestizische<br />
<strong>Gesellschaft</strong> Kolumbiens aufgesogen zu werden. Die<br />
Karibikküste Panamas bildete gleichermaßen eine<br />
nicht offizielle Pufferzone zwischen der britischen und<br />
spanischen Einflusssphäre. Erst im 19. Jahrhundert<br />
drängten mestizische Kautschuksucher die Kuna-<br />
Gemeinschaften immer mehr auf die vorgelagerten<br />
Inseln ab.<br />
1871 überließ die Regierung von Groß-Kolumbien<br />
den Kuna die Comarca de Tulanega, um die “Wilden<br />
zu zähmen“. Als Panama 1903 ein eigener Staat<br />
wurde, drangen immer mehr christliche Missionare in<br />
die Kuna-Region vor. Polizeistationen und staatliche<br />
Schulen wurden errichtet und sorgten <strong>für</strong> Angst und<br />
Unruhe unter den Kuna.<br />
Die in San Blas 1915 errichteten Staats-behörden<br />
verfolgten eine klassische Kolonialpolitik im Sinne<br />
der „Integration“ aller indianischen <strong>Völker</strong> des jungen<br />
Staates Panama. Nach Fertigstellung des Panamakanals<br />
drängten Tausende von Arbeitern aus Haiti und anderen<br />
Karibikinseln in die Kuna-Region und lösten heftigen<br />
Widerstand aus. 1925 rebellierten einige Kuna-<br />
Gemeinschaften zum ersten Mal offen gegen diese<br />
staatlich geförderte Überfremdung. Der bewaffnete<br />
Kampf <strong>für</strong> Selbstbestimmung begann am 25. Februar<br />
1925, als eine bewaffnete Gruppe von Kuna die Polizei<br />
auf den Inseln Tupile und Ukupsein angriff. Zuvor<br />
hatte die Polizei versucht, bestimmte Traditionen der<br />
Kuna zu verbieten. Nach dem Scheitern vieler Treffen<br />
zwischen Kuna-Führern und Staatsvertretern schaltete<br />
sich eine Delegation der USA als Vermittler ein. Erst<br />
1930 erkannte der Staat Panama die Autonomie der<br />
Kuna von San Blas an, die 1938 offiziell als Comarca<br />
228 In der Comarca Kuna Yala haben nicht-ethnische Kuna jedenfalls<br />
kein Recht auf den Erwerb von Grund und Boden.<br />
de San Blas gegründet wurde. Mit dem Gesetz Nr. 16<br />
von 1953 wurde die Autonomie der jetzt Comarca de<br />
Kuna Yala genannten Kuna-Region mit einem Statut<br />
besser definiert. Mit dem Gesetz Nr. 20 von 1957<br />
wurde die Comarca zur „Indianerreservation“ erklärt.<br />
Die heutige Rechtsgrundlage ist das Grundgesetz<br />
der Comarca Kuna Yala von 1995, das deutlich<br />
über den Reservatsstatus hinausgeht und einem<br />
Autonomiestatut gleichkommt.<br />
Nach dem Modell der Comarca Kuna Yala errichtete<br />
Panama zwei weitere den Kuna vorbehaltene<br />
Comarcas, die Kuna de Madugandí (1997) und Kuna<br />
de Wargandí. (2000). Schon 1983 hatten die Emberá<br />
(Wounaan) und 1997 die Ngobe-Buglé eine eigene<br />
autonome Comarcas erhalten. Auf einem Kongress<br />
von Kuna-Vertretern aller 68 Kuna-Gemeinschaften im<br />
April 2003 bekräftigten die drei Kuna-Territorien ihre<br />
Forderung, eine gemeinsame autonome Region zu<br />
gründen.<br />
3.14.2 Das Autonomiesystem<br />
Das Gesetz Nr. 16 von 1953, das die Comarca Kuna<br />
Yala begründete, kann als ein juridischer Pionierakt<br />
bezüglich der Territorialautonomie indigener <strong>Völker</strong><br />
Amerikas überhaupt betrachtet werden. Es anerkennt<br />
die Kuna als ein kollektives Rechtssubjekt mit dem Recht<br />
auf ein eigenes Territorium. Diese „Carta Organica del<br />
Regimen Comunal Indígena de San Blas” muss jedoch<br />
in Übereinstimmung mit der Verfassung Panamas<br />
und den nationalen Gesetzen angewandt werden. Sie<br />
errichtete genuin autonome Institutionen mit eigener<br />
Gesetzgebung im Rahmen der Staatsverfassung.<br />
Staatliche Akteure und Einzelpersonen hatten sich den<br />
Gesetzen der autonomen Comarca unterzuordnen,<br />
wenn sie auf deren Gebiet leben oder tätig werden<br />
wollten.<br />
40 Jahre lang bildete das Gesetz Nr. 16 von 1953 den<br />
rechtlichen Rahmen <strong>für</strong> die Autonomie der Kuna. Doch<br />
in den 90er Jahren entstand ein dringender Bedarf, die<br />
Koordination zwischen der autonomen Comarca und<br />
den staatlichen Behörden zu verbessern. Im Juni 1995<br />
genehmigte der Allgemeine Kongress der Kuna das<br />
Grundgesetz <strong>für</strong> Kuna Yala, das von einer autonomen<br />
verfassunggebenden Versammlung der Kuna vorgelegt<br />
und vom Kulturkongress, dem höchsten Organ der<br />
Kuna, 1995 abgesegnet wurde. 229 Diese vom nationalen<br />
Parlament 1998 gutgeheißene Grundgesetz bildet<br />
229 Congreso General Kuna de la cultura, Ley Fundamental de<br />
Comarca Kuna Yala, Urandí 1995<br />
151