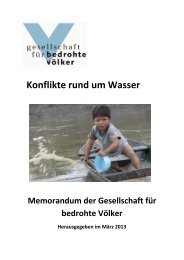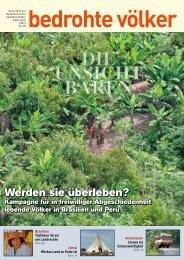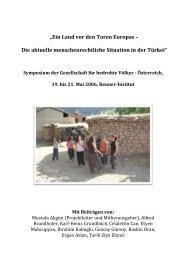Moderne Autonomiesysteme - Gesellschaft für bedrohte Völker
Moderne Autonomiesysteme - Gesellschaft für bedrohte Völker
Moderne Autonomiesysteme - Gesellschaft für bedrohte Völker
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
weniger einer streng individualistischen Konzeption<br />
von kulturellen Rechten verpflichtet sind, haben mit<br />
einigen Autonomieformen Probleme. So warnt Henry<br />
Steiner bei seinem Versuch, die Vielfalt und den<br />
Reichtum ethnischer Gruppen zu evaluieren, davor,<br />
eine Gemeinschaft hermetisch von den anderen<br />
trennen zu wollen:<br />
„Rechte, die autonome Regierungen und ethnische<br />
Minderheiten aufgrund der Menschenrechte bis hin<br />
zum Selbstbestimmungsrecht durch Autonomie<br />
erhalten, könnten als Ermächtigung interpretiert<br />
werden, den „anderen“ auszuschließen (...) Verstärkte<br />
ethnische Trennung verhindert beides: zum einen<br />
den Austausch zwischen Gruppen, und zum andern<br />
die kreative Entfaltung innerhalb getrennt („isoliert“)<br />
lebender Gemeinschaften. Dies führt zur Verarmung<br />
von Kulturen und <strong>Völker</strong>n (...). Dies heißt, dass ein<br />
Staat, der aus segregierten Regimes besteht, mehr<br />
einem Museum sozialer und kultureller Antiquitäten<br />
gleicht als jedem Ideal von Menschenrechten und<br />
friedlichem Zusammenleben.“ 102<br />
Dieses Argument ist besonders stichhaltig <strong>für</strong> die<br />
traditionelle Form der Indianerreservate Amerikas.<br />
Im Allgemeinen ist Regionalautonomie immer<br />
ein Ausgleich zum strukturellen Ungleichgewicht<br />
zwischen der kulturell dominanten Titularnation eines<br />
Staats und einzelnen Minderheiten. Verschiedene<br />
Formen gemeinschaftlicher Entscheidungsfindung<br />
innerhalb eines Autonomiesystems können dieses<br />
Risiko reduzieren. Doch letztendlich entscheidet der<br />
freie politische Prozess innerhalb einer autonomen<br />
Region und innerhalb der Minderheit selbst, wie<br />
das gewünschte Gleichgewicht wieder hergestellt<br />
wird. <strong>Moderne</strong> demokratische Rechtsstaaten sind<br />
schon aufgrund ihrer Verfassung und internationale<br />
Konventionen zur Achtung grundlegender<br />
Menschenrechte und politischer Freiheiten verpflichtet.<br />
Autonomiestatute und ihre rechtliche Anwendung<br />
muss diesen übergeordneten Normen entsprechen.<br />
<strong>Autonomiesysteme</strong> beruhen grundsätzlich auf<br />
der Annahme, dass kulturelle Unterschiede eine<br />
<strong>Gesellschaft</strong> bereichern als gefährden. Aber eine<br />
solche Vielfalt kann nur dann bereichern, wenn die<br />
verschiedenen Identitäten erhalten bleiben und nicht<br />
eingeebnet werden. In der globalisierten Welt muss<br />
kulturelle Vielfalt gegen (westliche) Homogenisierung<br />
102 Henry Steiner, Ideals and counter-ideals in the struggle over<br />
autonomy regimes for minorities, Notre Dame Law Review 66 (5),<br />
S. 1552, zitiert von Yash Ghai (2000), S. 501. Die Niederlassungsfreiheit,<br />
also das Recht, sich frei in und aus einer Region zu bewegen<br />
und sich dort anzusiedeln, bildet einen strittigen Punkt in der<br />
Regelung mancher Territorialautonomien.<br />
2 Das Konzept der politischen Autonomie<br />
verteidigt werden, und dies kann u.a. auch durch<br />
kulturelle Autonomie geschehen. In dieser Hinsicht<br />
hebt H.-J. Heintze hervor, dass<br />
„manche der Autonomie ankreiden, sie würde<br />
getrennte ethnische Identitäten einer Gruppe<br />
fördern, wodurch die betroffene Minderheit als<br />
verschieden herausgelöst werde. Die Existenz<br />
schlechthin eines solchen speziellen Status würde<br />
die Entwicklung von überlappenden, einschließenden<br />
Identitäten verhindern. Es besteht die Be<strong>für</strong>chtung,<br />
dass das Konzept einer <strong>Gesellschaft</strong> gleicher Bürger<br />
einer Zivilgesellschaft schlecht vereinbar sei mit der<br />
Herauslösung von spezifischen Gruppen aufgrund<br />
der Ethnizität.“ 103<br />
Und Svante Cornell warnt davor, dass die „ethnische<br />
Kantonisierung eines multiethnischen Staates oder<br />
jeder Form einer Konkordanzdemokratie auf lange<br />
Sicht nicht hilfreich sei, da es explizit zwischen Gruppen<br />
nach Religion, Sprache oder nationaler Herkunft<br />
diskriminiere. 104 Zwei Konzepte von Bürgerschaft und<br />
kultureller Identität stehen aneinander gegenüber,<br />
was diskutiert werden muss. Doch wiederum muss<br />
der freie demokratische Wille einer gegebenen<br />
Gemeinschaft voll berücksichtigt werden. Mit anderen<br />
Worten: Selbstbestimmung kann in verschiedenen<br />
Formen und unterschiedlichen Verfahren geschehen,<br />
doch muss es sich um eine „Bestimmung“ durch das<br />
betroffene, in diesem Fall kollektive „Selbst“ handeln.<br />
Schließlich unterstreichen die Gegner von<br />
Autonomielösungen oft, dass <strong>Autonomiesysteme</strong> in<br />
bestimmten historischen Fällen gescheitert sind. 105<br />
In der Tat, die Gesamtbilanz der Autonomie in ihrem<br />
Anliegen, ethnische Konflikte zu lösen, ist nicht völlig<br />
positiv. Es gibt eine Reihe von Beispielen, wo Autonomie<br />
Spannungen reduziert hat, andere wo Autonomie<br />
gescheitert ist. Doch gilt es sorgfältig zu analysieren,<br />
warum bestimmte Territorial-autonomien gescheitert<br />
sind: war einseitiges Handeln des Zentralstaats<br />
Ursache <strong>für</strong>s Scheitern? Lag der Grund da<strong>für</strong> im Fehlen<br />
eines echten demokratischen und rechtsstaatlichen<br />
Umfelds? Oder hat ein Wandel der internationalen<br />
politischen Rahmenbedingungen zum Scheitern<br />
geführt? Schließlich, waren eher interne Faktoren<br />
interethnischer Konflikte innerhalb der autonomen<br />
Region oder das Fehlen jeglichen interethnischen<br />
Zusammenwirkens in der Anwendung der Autonomie<br />
103 Hans-Joachim Heintze (2002), Implementation, S.340<br />
104 Svante Cornell (2001), Autonomy and conflict, Uppsala, 228<br />
105 Z.B. die Autonomie des Kosovo (Serbien) 1974-1989, Eritreas<br />
(Äthiopien) 1952-1968, des Südsudan 1954-83, und des Memel-<br />
Klaipeda-Gebiets zwischen den beiden Weltkriegen.<br />
59